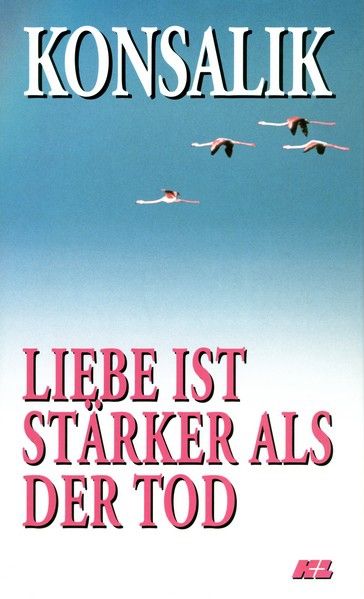![Liebe ist stärker als der Tod]()
Liebe ist stärker als der Tod
Als dann die Polizei erschien, um uns festzunehmen, wandelte ›Das Gebetbuch‹ von Notre Dame herüber, in einer Soutane, tatsächlich in einer Soutane, weiß der Satan, wo er sie in Notre Dame geklaut hat, hebt die Hände und predigt: ›Hüter der Ordnung, dies hier ist ein gottgefälliges Werk. Wir sammeln für die hilflos im Bett Liegenden.‹ Und die Polizisten legen die Hände an die Käppis, greifen in die Taschen, spenden selbst ein paar Francs und marschieren wieder ab. Ponpon, der sich noch immer als unentwirrbares Knäuel aus Gliedern selbst den Arsch leckte, lachte so, daß er sich kaum noch entwirren konnte. Und dabei hat ›Das Gebetbuch‹ nicht einmal gelogen: Liegt Ev nicht hilflos im Bett?«
»Laß mich allein, Henry«, sagte Pierre. Er setzte sich vor die Staffelei, zog das Tuch von dem halbfertigen Bild und starrte es an. Ev, gemalt im Stil einer alten russischen Ikone. Er hatte es vor drei Tagen begonnen, aus einem plötzlichen Impuls heraus. Es war am Abend gewesen, Ev hatte an dem großen Fenster gestanden und über die Dächer geblickt, und das rote Gold einer untergehenden Sonne hatte ihren Kopf umgeben wie die Gloriole auf den alten Heiligenbildern.
Jetzt fand er es schrecklich und konnte sich doch nicht dazu aufraffen, die Leinwand zu zerreißen. Ist das Ev, fragte er sich? Ist sie für mich wirklich eine Heilige? Sehe ich sie nicht ganz anders, wenn ich alleine bin und an sie denke? Sehe ich sie nicht dort drüben im Bett liegen, nackt und überaus menschlich, verführerisch und manchmal sogar verrucht aufreizend? Sitze ich dann nicht da und wünschte nur, zu ihr zu stürzen und mir die Kleider vom Leib zu reißen und so sein zu dürfen, wie ich es träume? Ist Ev nicht ein greifbarer Körper, jung, von warmem Blut durchpulst, von vibrierenden Nerven geleitet, von Sehnsüchten durchströmt. Lippen, die sich öffnen, Brüste, die unter dem Atem beben, Schenkel, die sich öffnen. Ist sie das nicht auch?
»Ich habe Tee mitgebracht und zwei Bratheringe«, sagte der ›Rote Henry‹ profan. »Nach langen Diskussionen hat sich ›Das Gebetbuch‹ bereit erklärt, von der mildtätigen Sammlung zehn Francs für unser leibliches Wohl abzuzweigen. ›Der Herr wird's verzeihen‹, hat er dabei gesagt. ›Auch wir sind hilfebedürftig.‹ Manchmal könnte man ihm in den Arsch treten, wenn nicht immer die heilige Scheu dabei wäre. Aber ich tu's einmal, Pierre … bestimmt, wenn er Bischof geworden ist.«
Pierre zerriß das Ikonenbild nicht. Er stellte es nur an die Wand, holte eine andere Leinwand und starrte mit leeren Augen den großen weißen Fleck an. Hinter ihm summte der Wasserkessel, rumorte der ›Rote Henry‹ herum, wickelte seine Bratheringe aus und gab Bouillon einen der Schwänze zu fressen.
Ich werde nie ein großer Maler, dachte Pierre. Professor Mauron hat es mir jetzt gesagt. Ich werde nie so malen können, wie ich Ev liebe. Es wäre das Chaos auf der Leinwand …
Um ein Uhr nachts kam Wladimir Andrejewitsch die Treppe hoch. Madame Coco war noch auf, saß am Küchentisch, legte Karten und begrüßte den Fürsten mit einem unheilvollen Knurren. Wann sie schlief, war genau so rätselhaft wie das, was sie aus den Karten herauslas.
»Wir haben heute die ganzen Kosten von Ev übernommen!« sagte Fürst Globotkin und schob die Mütze in den Nacken. Dann knöpfte er die Jacke auf, denn bei Madame war es drückend heiß. »Von uns aus kann Ev vier Wochen im Krankenhaus liegen.«
Madame Coco war nie eine schöne Frau gewesen, zumindest konnte sich keiner in der Rue Princesse mehr daran erinnern, daß sie tatsächlich eine Schönheit gewesen war, zart und glutvoll, genau die Mischung, die Männer zu Idioten werden läßt. Daß sie jetzt mit großen Fischaugen dasaß und mit den dicken Händen ihre Karten durchwühlte, erschreckte keinen mehr, der sie nur als rotes Monstrum kannte.
»Ihr seid das?« sagte sie endlich. »Fürst, ich möchte dich küssen!«
Wladimir Andrejewitsch zog es vor, schnell die Treppe hinaufzulaufen, um einer durchaus möglichen Umarmung zu entfliehen. Dafür schellte Madame Coco rücksichtslos Monsieur Callac aus dem Schlaf und brüllte ihn per Telefon an.
»Der Unbekannte sind die Taxifahrer!« schrie sie.
Callac schüttelte den Hörer, fand sich in der plötzlich gegenwärtigen Welt nicht gleich zurecht und atmete pfeifend.
»Welche Taxifahrer?« fragte er dann.
»Schlaf weiter, Marius!« brüllte Madame Coco. »Die heutige Jugend ist anständiger, als
Weitere Kostenlose Bücher