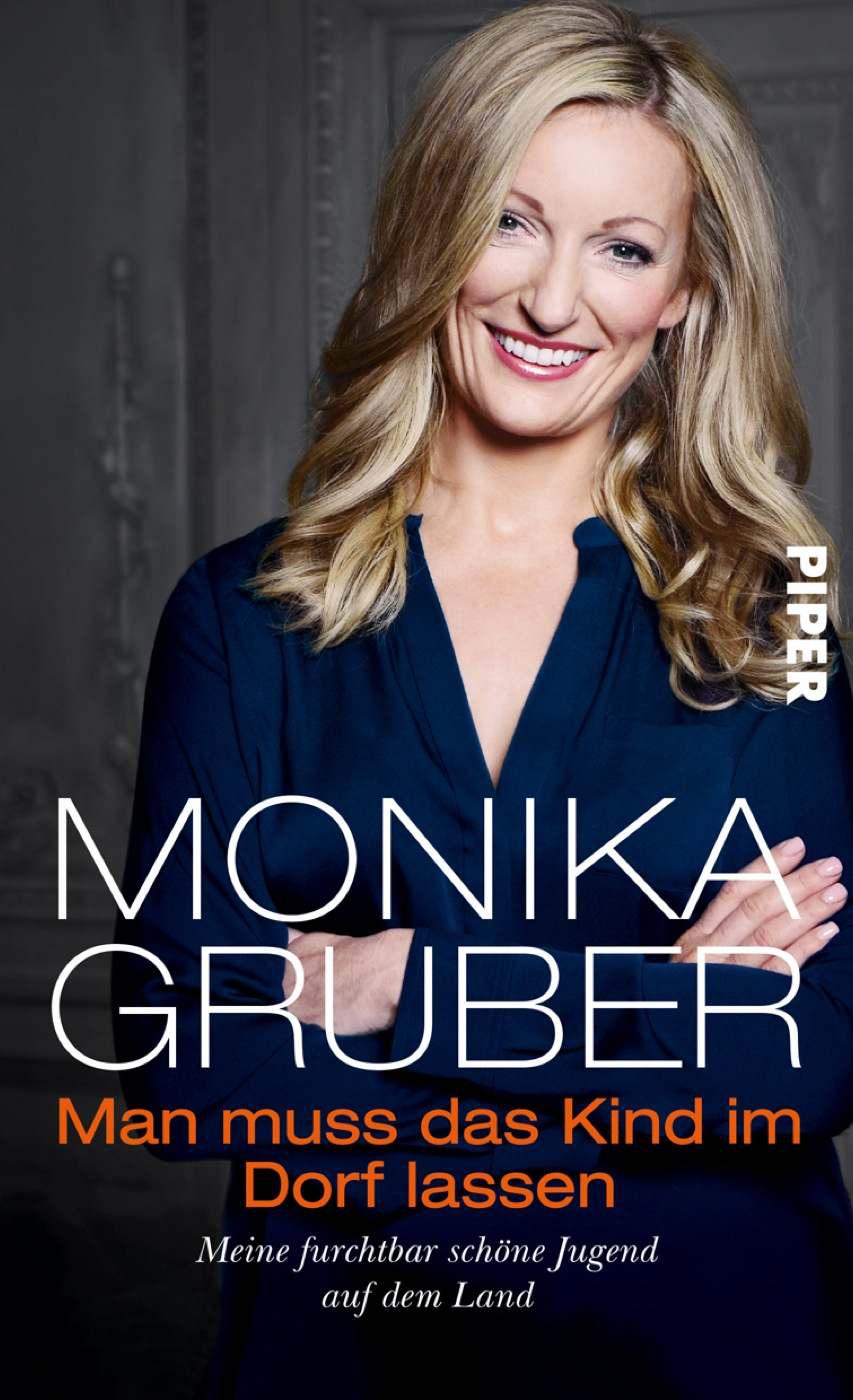![Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)]()
Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)
mein Vater beim Anpirschen an ein Blech schon immer vorsichtig:
»Von welchem Blech derf ich was nehma?«
Mama: »Ned von die Scheena!«
Paps: »Wo san die Scheena?«
Mama: »Des sieht ma doch!«
Paps: »I ned.«
Bei völligem Misslingen eines Gebäcks oder Kuchens – also wenn die Kirchweihnudeln zum Beispiel einen halben Zentimeter niedriger sind als sonst – ist meine Mutter so persönlich gekränkt, weil ihr das nach so langen Jahren in der Küche widerfahren muss, dass sie wild auf dem Objekt ihres Unmuts herumdrückt und vor sich hinprustet: »Na, glaubst es – ich schmeiß des Glump zum Fenster naus, sollen’s die Hühner fressen!«
Selbst wenn man sie mit den Worten zu trösten versucht: »Aber es schmeckt doch trotzdem guad!« – von ihr kommt nur ein durch die Zähne Gezischtes: »I mags ned… diese zammg’hockten Dotschn!«
(Das Wort »Dotschn« lässt sich übrigens auf unförmiges, missratenes Gebäck genauso gut anwenden wie auf ebenso gebaute, etwas unbeholfene Frauen und ist in beiden Fällen nicht als Kompliment gedacht.)
Denn wie beim Eiskunsttanz bedeutet in der Küche meiner Mutter ein unperfektes Äußeres: Abzüge in der B-Note. Die Qualität ist gemindert, die Stimmung gedämpft.
Dieser hohe Anspruch an ihre Koch- und Backkunst kam nicht von ungefähr, war doch ihre Mutter, meine Oma, genauso erpicht darauf, dass alles, was aus ihrer Küche kam, nicht nur gut schmecken, sondern auch optisch ein Leckerbissen sein musste.
Wenn meine Oma zu Besuch war und die frisch gebackenen Schuxn (ein herzhaftes, längliches Sauerteiggebäck, das außen knusprig und innen hohl ist) oder Schmalznudeln meiner Mutter von allen Seiten fachfraulich betrachtete, sie unter leichtem Drücken drehte und wendete und schließlich davon probierte, meinte sie oft anerkennend: »Schee sans … guad sans auch!«
Mama: »Ja, aber so schee wie die deinen sans ned!«
Oma: »Stimmt.«
Oh, diese kleine Spitze reichte, um meine Mutter anzustacheln, ihre Küchenfertigkeiten weiter zu perfektionieren.
Trotzdem habe ich in all den Jahren und auch nach Dutzenden kulinarischen Patzern nie gesehen, dass meine Mutter ein Blech Kuchen in den Garten segeln ließ. Natürlich nicht. Bei uns wurde nie irgendetwas weggeschmissen, was unter den Begriff Lebensmittel fiel. Aber ich glaube, sie hätte es oft gern getan.
Wie die meisten bayerischen Frauen vom Land war auch meine Mutter eine der Frauen, bei denen immer der Pragmatismus siegte: Jeden, absolut jeden Fleck konnte man mit Schmierseife entfernen, alles Verlorene konnte durch Beten zum Heiligen Antonius wiederbeschafft werden, bei körperlichen Schmerzen halfen Melissengeist, Lindenblütentee und eine Wärmflasche, bei seelischen ein gutes Stück Kuchen, ansonsten heilen die Zeit und Humor alle Wunden, Gesundheit und Kinder sind das Wichtigste im Leben, und Essen wird nur dann weggeschmissen, wenn der grüne Schimmelteppich nicht mehr mit einem beherzten Schnitt oder Griff entfernt werden kann.
Und dass man als Frau immer gedanklich der Männerwelt voraus sein muss, das hat einmal eine entfernte Verwandte – aus Diskretionsgründen nenne ich sie nachfolgend »Gschwendner Irmi« – in schönster Perfektion bewiesen, als sie sich zusammen mit ihrer Schwester, die wir hier Maria nennen, zum Krankenbesuch von ihrem gemeinsamen Onkel Albert aufgemacht haben. Der Krankenbesuch war längst überfällig, denn wie die beiden von Onkel Alberts Frau, der Lisbeth, erfahren hatten, war es um die Gesundheit des Onkels nicht zum Besten bestellt: Er war bereits seit über einer Woche im Krankenhaus, und die Ärzte konnten immer noch kein genaues Entlassungsdatum benennen und hielten sich, was den Krankheitsverlauf anbelangte, sehr bedeckt. Selbst die Tante Lisbeth konnte nicht genau sagen, woran es ihrem Mann eigentlich fehlte. Sie wusste nur, er sprach nicht mehr viel, fühlte sich seit Tagen so schwach und wollte nicht mehr essen. Und da Appetitlosigkeit natürlich in Bayern – auch im hohen Alter – als alarmierendstes aller genannten Krankheitssymptome einzustufen war, machten sich die beiden Schwestern Irmi und Maria mit ihrer Tante Lisbeth auf dem Weg ins Krankenhaus.
Als die Irmi von ihrem Krankenbesuch nach Hause kam, war es schon spät und ihr Mann Bertl saß mit den Kindern bei der abendlichen Brotzeit. Als dieser nachfragte, wo sie denn so lang gewesen sei und wie es denn dem Onkel Albert gehe, sagte sie nur:
»Den reißts weg!«
»Was?«
»Der stirbt! Des
Weitere Kostenlose Bücher