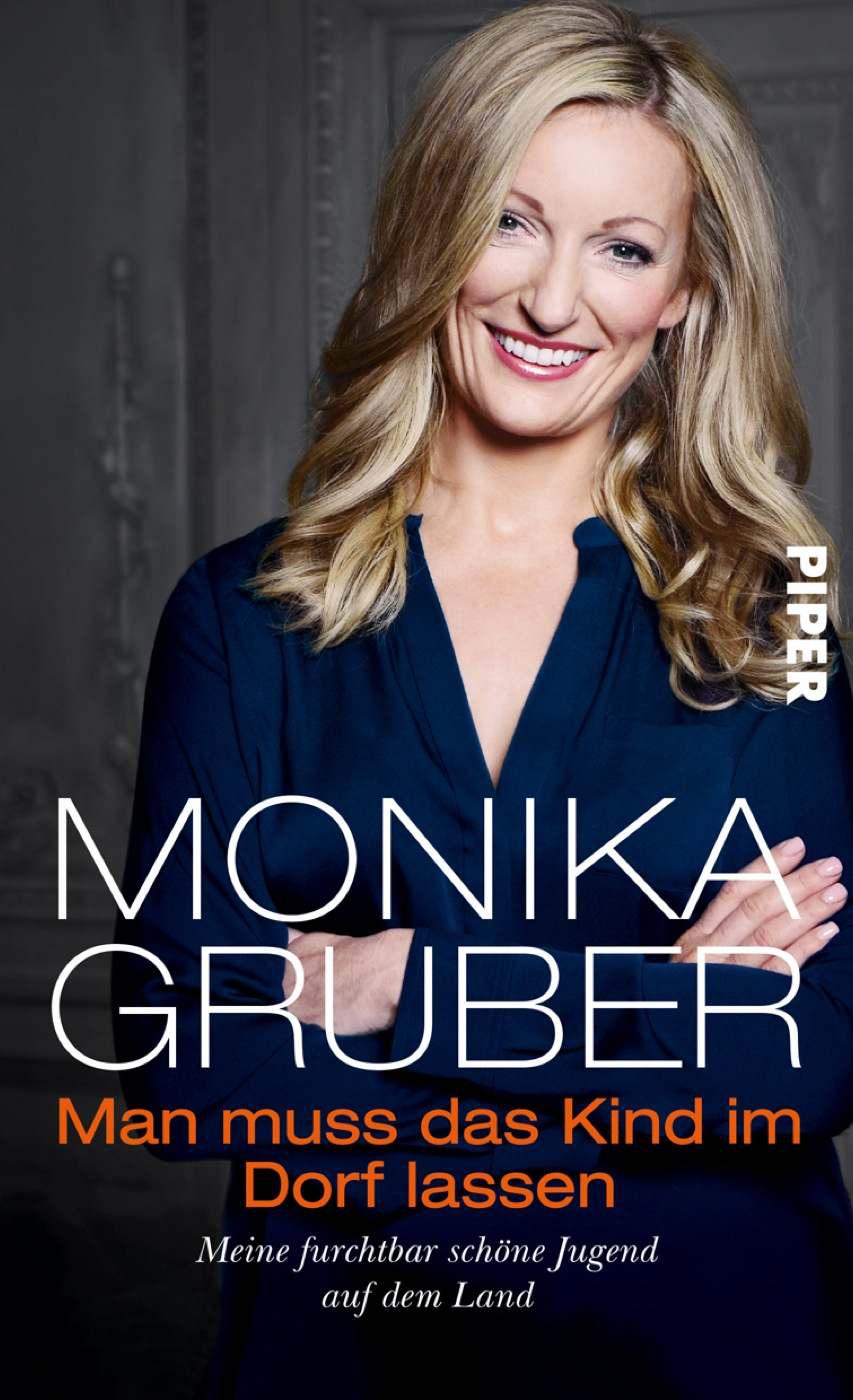![Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)]()
Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)
wäre, würde ich Folgendes machen: Eltern, die ihren Kindern bescheuerte Namen geben, werden dazu verpflichtet, zehn Prozent ihres Nettogehaltes (falls vorhanden) für Erforschung schwerer Erbkrankheiten zu spenden und darüber hinaus zwölf Stunden pro Tag ein T-Shirt zu tragen, auf dem in großen Lettern zu lesen ist: ›Ich bin wahnsinnig, denn mein Kind heißt Priscilla Birnbichler!‹ Außerdem werden sie gesetzlich dazu verpflichtet, einmal im Leben bei ›Frauentausch‹ oder bei ›Die Auswanderer‹ mitmachen zu müssen. Bei Letzterem müssten sie allerdings gegen eine Zahlung von 5 0 000 Euro aus der deutschen Staatskasse unterschreiben, dass sie nie mehr nach Deutschland einreisen werden. Während die Kinder im Gegenzug die Möglichkeit bekommen, sich im Alter von sechzehn Jahren kostenlos einen anderen Namen auszusuchen und ihren eigenen Eltern ebenfalls einen völlig neuen Vor- und Nachnamen verpassen dürfen. Heißt der Vater von Kimberly Princess Leia Haftlmacher zum Beispiel Jürgen, würde ich den wohlklingenden Namen Skywalker Domestos Arschgeige vorschlagen.«
Servicewüste Gruber
Vierzehn Jahre meines Lebens habe ich gekellnert. Anfänglich nur so nebenbei. Denn in meinem früheren Leben hieß ich »Personal Assistant to the Vice President Consumer Marketing for Europe, Middle East and Africa« und war als solche bei einer großen amerikanischen Computerfirma angestellt, die allerdings ein paar Jahre nach meinem Ausscheiden von ihrem nimmersatten Heuschrecken-Manager-Gschwerl an die Wand gefahren wurde. Die offizielle Bürosprache damals war Englisch, und so fristete ich an vier Tagen die Woche mein Dasein im dunklen Hosenanzug (am Freitag durfte jeder in Jeans auftauchen) zwischen grauen Endloskorridoren, einer grauen Kantine und einem dunklen Büro in der tristen Peripherie von München. Zehn Stunden täglich wickelte ich belanglose Korrespondenz und Reisekostenabrechnungen für Menschen ab, für die ich mich nicht interessierte und die sich nicht für mich interessierten – umso mehr freute ich mich immer auf das Wochenende.
Denn wenn ich meist komplett in Schwarz gekleidet und auf riesig hohen schwarzen Plateau-Turnschuhen im Lokal auftauchte, mir meine schwarze Schürze und den schwarzen Gürtel mit dem Geldtascherl umband, dann sah ich aus wie ein 1 Meter 85 großer blonder Kellnertransvestit: zu groß für eine Durchschnittsfrau, dunkle Raucherstimme und ein Make-up, das auch drei Unterwassershows des Cirque du Soleil überstanden hätte … Dann war ich auf meiner Bühne, und die Gäste waren die bedauernswerten Zuschauer, die über meine Sprüche lachen und mir dafür ein ordentliches Trinkgeld geben sollten. Dort fühlte ich mich wohl, ich wurde gemocht, meine Arbeit wurde geschätzt, und außerdem verdiente ich mir etwas »Schwanzelgeld«, also das Geld, das wir Frauen gern mal einfach so für Dinge hinausblasen, die kein Mensch braucht und die wir immer dann entdecken, wenn wir durch die Stadt bummeln (»schwanzeln«).
Ein paar Jahre später, als ich mich mit siebenundzwanzig Jahren dazu entschloss, meinem mauerblümchenartigen Bürodasein den endgültigen Garaus zu bereiten und die Schauspielschule zu besuchen, musste ich allerdings tatsächlich meinen Lebensunterhalt komplett mit Kellnern bestreiten. Also ging ich untertags auf die Schauspielschule, und abends jonglierte ich an circa fünf Abenden in der Woche Cola-Weißbier, Salat Pute und Teufelstoasts durch die eng gestellten Tische einer Kneipe in Erding, die den klingenden Namen »Bierteufel« trug und im bajuwarischen Volksmund natürlich »Bierdeife« ausgesprochen wurde. Zusätzlich – schließlich war die Schule und vor allem auch das Benzin von Erding nach München und wieder zurück teuer – kellnerte ich über mehrere Jahre hinweg jeden Sonntagmittag beim Alten Wirt, einem gutbürgerlichen Speiselokal in der Nähe von Freising.
Aber die meiste Zeit meines Kellnerdaseins habe ich mit Sicherheit im Bierteufel verbracht, einem leicht angeranzten, völlig verrauchten Pilspub, in dem ein guter Querschnitt der Bevölkerung verkehrte: vom arbeitslosen Alkoholiker über den zockenden Chirurgen bis hin zum Elternbeirat des örtlichen Gymnasiums und vielen (Hobby-)Sportlern. Darunter waren zum Beispiel – sehr zu meiner Freude – die Profieishockeyspieler von den Eisbären Berlin, die immer dann bei uns vorbeischauten, wenn sie gegen unser Erdinger Team gewannen. Ich bin mir nicht sicher, ob nun das kraftintensive
Weitere Kostenlose Bücher