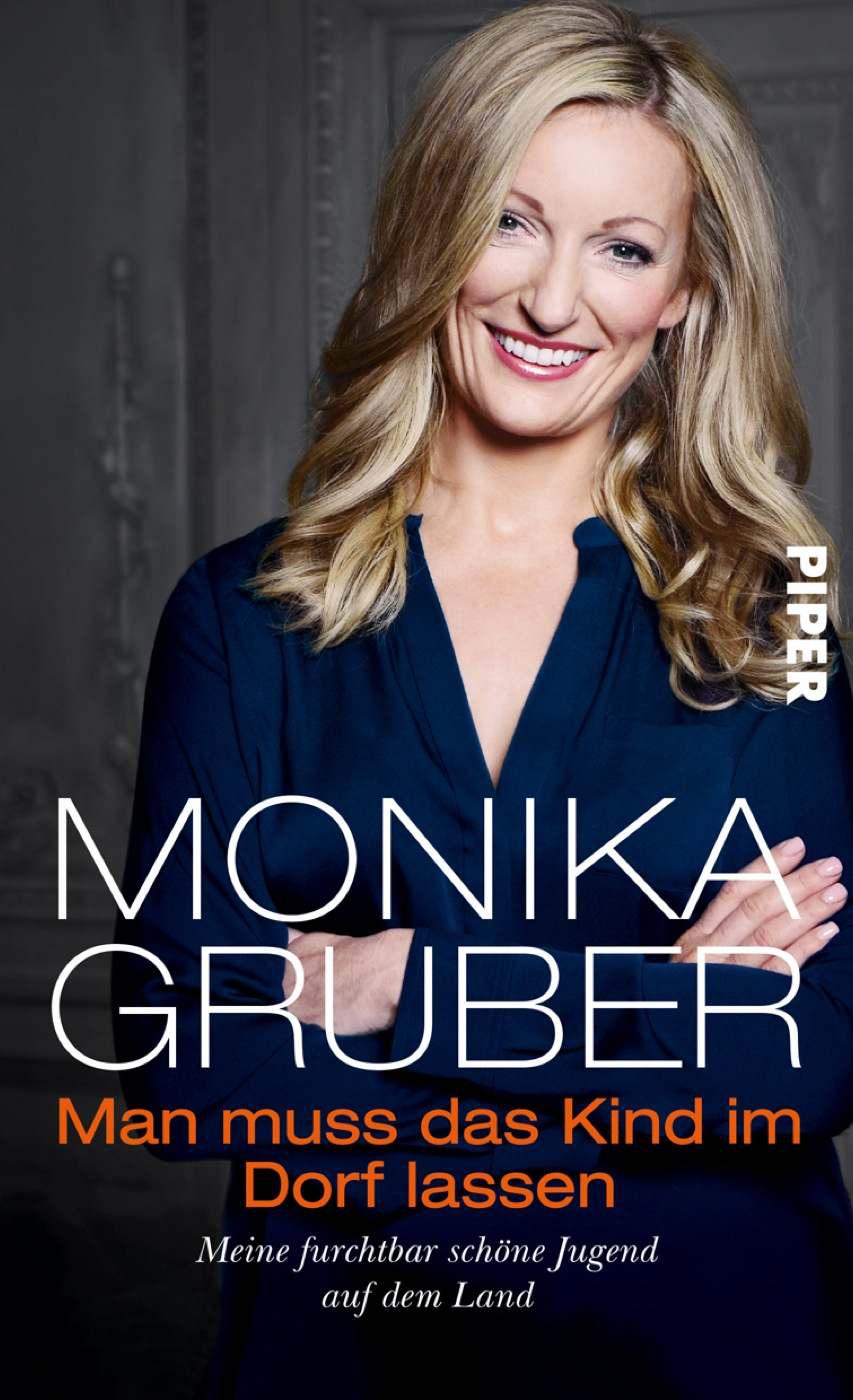![Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)]()
Man muss das Kind im Dorf lassen: Meine furchtbar schöne Jugend auf dem Land (German Edition)
mir an die Theke, gab mir fünf Euro und meinte: »Ich schäme mich für meine Frau.«
♦ Ein stadtbekannter Taugenichts, der eher selten bei uns im »Bierdeife« vorbeikam und immer drei verschiedene Getränke gleichzeitig bestellte (Bier, Rotwein und Ramazotti) und dazu drei verschiedene Packungen Zigaretten auf seinem Platz ausgebreitet hatte, begann ein Gespräch mit meiner Freundin, die mit ihrem Mann an der Theke saß. Plötzlich begann der Typ, obwohl er vollkommen nüchtern war, den Mann meiner Freundin, der Engländer ist, auf Englisch und Deutsch als »Scheißengländer« und »depperten Ausländer« zu beschimpfen. Ich sagte ihm, er möge sofort zahlen und gehen, da er ab sofort Hausverbot habe, denn in unserem Lokal würden keine Ausländer beschimpft, nur Deppen, und die Tatsache, dass jemand ein Depp sei, sei ja wohl länderunabhängig. Der Typ, der einen guten Kopf größer war als ich, machte sich über mich lustig, grinste mich höhnisch an und sagte, ich hätte gar kein Recht, ihn hinauszuschmeißen. Da Börnie an diesem Tag frei hatte, packte ich ihn an seiner Lederjacke mit den Worten: »Burli, da hamma scho Größere nausgschmissen wie dich – und deine Getränke gehen aufs Haus!« Der Typ war riesengroß und wehrte sich, aber mithilfe eines Stammgastes konnte ich ihn schließlich zur Tür hinausschieben, während er laut vor sich hinbrüllte. Drei Tage später wurde ich aufs Polizeipräsidium Erding gebeten: Der Typ hatte tatsächlich die Frechheit besessen, mich wegen schwerer Körperverletzung anzuzeigen. Der zuständige Beamte schüttelte aber nur lachend den Kopf und meinte: »Mir wissen selber, dass des ein Depp is’, aber wir müssen halt jeder Anzeige nachgehen, verstehen S’!« Ich verstand und verzichtete meinerseits auf eine Anzeige wegen rassistischer Äußerungen.
Obwohl ich diese Liste noch eine Weile fortsetzen könnte, würde ich jedem jungen Menschen, der in der Lage ist, mehr als hundert Schritte geradeaus zu gehen und 3,20 und 2,50 addieren kann, ohne dazu sein iPhone benutzen zu müssen, raten, eine Zeitlang in der Gastronomie zu jobben. In kürzester Zeit wird jeder zwei Dinge verstanden haben: Ohne Fleiß kein Preis, und Freundlichkeit zahlt sich unterm Strich immer in barer Münze aus. Eine Lektion, die mir im Leben schon oft von großem Nutzen war.
Die Bühne
Eine der häufigsten Fragen, die ich in den letzten zehn Jahren gestellt bekommen habe, lautet: »Wie sind Sie eigentlich zum Kabarett gekommen?«
Eine Frage, die ich immer mit dem Satz beantworte: »Ich wusste immer, ich werde irgendwann Schauspielerin.« Dann kommt immer als Rückfrage: »Aha, nicht Kabarettistin?«
Darauf weiß ich oft nicht so recht, was ich antworten soll. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich eine Kabarettistin bin. Und ehrlich gesagt, ist mir das auch vollkommen wurscht. Ich denke sowieso nicht in diesen Schubladen … Kabarettistin oder Komikerin? Clown oder Comedian? U- oder E-Unterhaltung? Alles Schwachsinn. Ich wollte einfach immer nur Schauspielerin werden.
Komisch eigentlich, denn niemand in meiner Familie – weder väterlicher- noch mütterlicherseits – hatte jemals zuvor einen künstlerischen Beruf ergriffen. Wahrscheinlich weil man auf dem Land gemeinhin der Meinung war, dass »Kunst« und »Beruf« zwei Dinge sind, die sich eigentlich ausschließen. Schon allein deshalb, weil sich mit Kunst doch höchstens posthum Geld verdienen lässt. Und wer bitte würde sich so etwas allen Ernstes für seinen Ableger wünschen?
Trotzdem: Schon als Kind war ich fasziniert von Schauspielern und diesem völlig verrückten Beruf. Ich war süchtig nach Fernsehserien, vor allem den amerikanischen, denn dort waren selbst die kleinsten Nebenrollen perfekt besetzt, und alle spielten um ihr Leben. Oft versuchte ich vor dem Alibert-Spiegel in unserem Bad auf Kommando zu weinen oder den kühl-spöttischen Blick von Lauren Bacall zu imitieren, die ich vergötterte. Ich versuchte, mein Gegenüber im Spiegel – also mich selbst – möglichst lange, ohne zu blinzeln, zu fixieren, um dann in ein diabolisches Lachen auszubrechen, wie ich es immer bei Christopher Walken bewunderte. Nur, dass es bei mir weniger nach diabolischem Lachen als nach seltsamem Wiehern klang, das mich leider sehr an unsere beiden gefräßigen, aber gutmütigen Zwergponys erinnerte. Wenn mich jemand aus meiner Familie dabei ertappte, war es mir peinlich, und auf die Frage, was ich denn da im Bad für einen »Zirkus«
Weitere Kostenlose Bücher