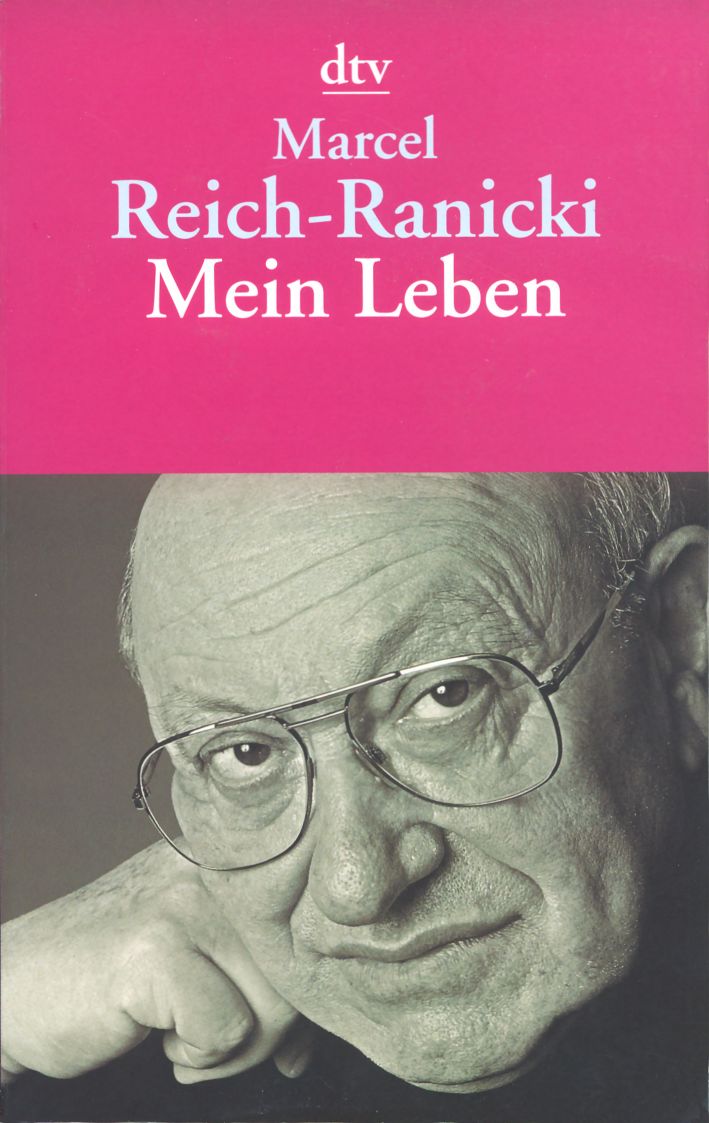![Mein Leben]()
Mein Leben
nicht unbekannt, und so muß ich Verständnis für ihre Racheakte und Haßausbrüche haben. Nur scheinen mir manche dieser Ausbrüche die Grenzen des Humanen nun doch überschritten zu haben. Vielleicht sind sie als Symptome unseres literarischen Lebens erwähnenswert.
Den jungen Autor Rolf Dieter Brinkmann habe ich 1965 in der »Zeit« als neues Talent der deutschen Prosa freudig begrüßt. 1968 habe ich seinen ersten Roman »Keiner weiß mehr« enthusiastisch gerühmt, ebenfalls in der »Zeit«. Im November 1968 saßen wir, Brinkmann und ich, zusammen auf dem Podium der Akademie der Künste in Berlin. Ich hatte ihn unmittelbar vor der Veranstaltung zum ersten Mal gesehen. Zu meiner Überraschung schaute er mich wütend an. Ich ahnte nicht, daß er auf einen Skandal aus war. Unsere Diskussion dauerte noch nicht lange, da brüllte er mich ohne erkennbaren Anlaß an: »Ich sollte überhaupt nicht mit Ihnen reden, ich sollte hier ein Maschinengewehr haben und Sie niederschießen.« Das Publikum war empört und verließ aufgeregt den Saal. Brinkmann hatte nun den Skandal, an dem ihm offensichtlich so gelegen war. Seine Verlagslektorin wollte mich beschwichtigen: »Sie sind doch für ihn eine Vaterfigur, und dazu gehört auch der Vatermord – dafür sollten Sie Verständnis haben.« Ich hatte dafür kein Verständnis.
Meinen Tod wünschte auch Peter Handke, jedenfalls würde er ihn nicht bedauern: In seinem aus dem Jahr 1980 stammenden Buch »Die Lehre der Sainte-Victoire« stellt er mich als bellenden und geifernden »Leithund« dar, »in dem sich gleichsam etwas Verdammtes umtrieb« und dessen »Mordlust« vom Getto noch verstärkt worden war. Auch die hochbeachtliche Lyrikerin Christa Reinig hat sich meinen von ihr ersehnten Tod vorgestellt – und sehr ausführlich. Der Ordnung halber sei gesagt: Ich habe nie auch nur ein einziges Wort gegen sie verlauten lassen, wohl aber manches zu ihren Gunsten. In Christa Reinigs 1984 veröffentlichtem Buch »Die Frau im Brunnen« klagt ihr Freund, er könne nicht weiterschreiben, weil er bei jedem Satz daran denken müsse, wie ich sein Buch beurteilen werde. Es soll in einem Jahr fertig sein. Er wird beruhigt: »Ich sage: Da ist der Reich-Ranicki längst tot… Vielleicht nagt eine geheime Krankheit an ihm. Ein Krebsgeschwür, ein Herzinfarkt, eine Geisteskrankheit. Das alles kann schon im nächsten Monat zum Ausbruch kommen, und dann bist du frei zu schreiben, was du willst. Er lacht über meine Kindlichkeit. Nein, das alles ist ganz ausgeschlossen. Ich sage: Dann wird er einen Verkehrsunfall bauen, er wird überfahren werden oder von einem Rechtsüberholer geschnitten und zerquetscht.«
Die Geschichte der Literaturkritik, und nicht nur der deutschen, lehrt, daß jene, die viel verreißen, besonders oft attackiert und ihrerseits verrissen werden. Darin mag man eine tiefere Gerechtigkeit sehen. Jedenfalls war das literarische Gewerbe seit eh und je gefährlich: Wer es ernsthaft ausübt, riskiert viel, und wer Wind sät, muß damit rechnen, daß er Sturm erntet. Also keine Klagen, keine Beschwerden meinerseits. Doch will ich nicht verheimlichen, daß mich die Brutalität mancher gegen mich gerichteter Äußerungen verblüfft hat.
Hat die Brutalität dieser Schriftsteller mit ihrer Empfindlichkeit zu tun, mit ihrer Eitelkeit? Thomas Mann war ichbezogen wie ein Kind, empfindlich wie eine Primadonna und eitel wie ein Tenor. Aber er meinte, daß die Egozentrik die Voraussetzung für seine Produktivität sei: Nur der quäle sich, der sich wichtig nehme. Er hatte keine Bedenken zu behaupten, daß alles, was »gut und edel scheint, Geist, Kunst, Moral – menschlichem Sichwichtignehmen« entstamme. Weil die Schriftsteller alles stärker und intensiver empfinden als andere Menschen, müssen sie sich mehr als andere quälen. Ihr Bedürfnis nach fortwährender Selbstbestätigung hängt damit zusammen. Das leuchtet ein, aber verwunderlich mag sein, daß der Erfolg eines Schriftstellers, sogar der Welterfolg, dieses Bedürfnis nicht im geringsten mindert.
Die relativen Mißerfolge Goethes – von der »Iphigenie« bis zu den »Wahlverwandtschaften« – haben ihn offenbar mehr geschmerzt, als ihn seine wahrhaft internationalen Triumphe beglücken konnten. Thomas Mann gierte förmlich nach Lob, er war süchtig nach Anerkennung. Von kritischen Äußerungen über sein Werk wollte er nichts wissen, er bestand darauf, daß sein Verleger, seine Sekretäre und Familienangehörigen derartige
Weitere Kostenlose Bücher