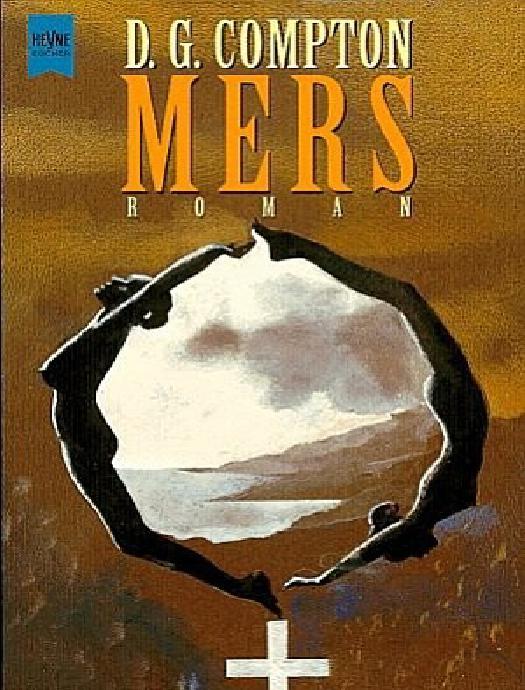![MERS]()
MERS
habe.«
Der Tag war traurig, ebenso das Haus, und jetzt auch, für
mich, dieses Zimmer. Nicht jedoch Julius. Er saß in der Ecke
eines der riesigen alten Samtsofas, neben sich ein Teetablett.
Palestrina tönte vom Plattenspieler, die Kinderstimmen, die er
so liebte. Er stemmte sich aus dem Sofa hoch und lächelte
warm.
»Meine Liebe, wie schön, dich zu sehen. Ich hole noch
eine Tasse.«
Wir umarmten uns.
»Pscht!« sagte ich. »Ich verderbe die
Musik.«
»Tust du nicht.« Er legte einen Finger an die Lippen,
schob mich zu einem Sessel und ging die vertraute Wendeltreppe zur
Küche hinab. Ich setzte mich hin, kämpfte kurz mit den
Kissen und hörte Palestrina.
Ich habe gesagt, für mich war der Raum traurig. Das ist
Nostalgie. Anders als das Haus der Stollmans hatte sich das
Wohnzimmer der Stollmans nicht verändert. Dort hatte es schon
immer Spinnweben gegeben. Zwanzig Jahre lang zwei alte Menschen, dann
einer, die Abnutzung war minimal, eine Veränderung um ihrer
selbst willen unnötig. Da lag die Traurigkeit, meine
Traurigkeit. Hier hatte ich Prokofieff heruntergehämmert, und
jetzt war ich eine erwachsene Frau. Es war keine Verbesserung.
Die Musik hörte auf. Das war ebenfalls traurig gewesen –
dieses seltsame Zelebrieren der Traurigkeit, das großer Kunst
gelingt, aber ich hatte lediglich die Traurigkeit gehört. Ich
war in meiner Stimmung befangen, und mir hatte das Zelebrieren
gefehlt.
Julius tauchte wieder auf; ganz rosig im Gesicht, weil er so
strahlte. Er trug einen Teller, eine Tasse und ein Kännchen,
dazu die vertraute Keksdose. Er stellte diese Sachen auf das
Tablett.
»Du siehst blaß aus, Harriet. Hast du dieses verdammte
Heilmittel noch immer nicht gefunden?«
Ich hob die Schultern. »Ich glaube schon. Ich weiß
es.« Meine Stimmung hob sich nicht.
»O Mann, was für eine Verantwortung!« Er ließ
sich aufs Sofa nieder und klopfte sich ein Nest zusammen.
»Verdammte Sache… Nicht deine Verantwortung, die
Verantwortung der Mütter. Die ersten kleinen Jungen seit vierzig
Jahren. O Mann!«
Ich hatte andere Sorgen. »Ich stecke ein wenig in
Schwierigkeiten, Julius. Ich würde gern bis Mitternacht
bleiben.«
»Bleiben? So lange du magst… Das Schwierige daran ist,
daß sie in den ersten zwanzig Jahren ohne jede Väter
heranwachsen.«
»Ich weiß.« Es war nicht mein Problem.
»Eigentlich sogar etwa dreißig Jahre. Du brauchst nicht
aufzustehen. Ich finde selbst hinaus.«
»Die Männer, welche die Zukunft gestalten. Meine
Göttin… und besser als das letzte Mal, wenn es ihre
Mütter richtig hinkriegen.«
Nicht mein Problem. »Du hörst nicht zu, Julius. Das hast
du nie getan.«
Nicht mein Problem? Jesses. Mein Herz setzte einen Schlag aus.
Drei deutliche Schläge lang, ich schwöre es. Jesses, meine
Blutung war ausgeblieben. Laut Kalender hätte sie fällig
sein sollen, und ich hatte keine gehabt. Ich war schwanger. Ich
preßte die Beine zusammen, bis mir die Knie schmerzten. Eine
Woche Verspätung war gar nichts, eine Woche wie diese konnte es
verursacht haben, konnte den Fluß aufgehalten haben, das
hätte ich jeder Frau gesagt, die zu mir gekommen wäre, aber
ich wußte, ich war schwanger. Frauen wissen das. Eigentlich
wissen sie’s nicht, aber ich wußte es. Und ich
wußte, es war ein Junge. Der erste. Es sei denn, diese
Beduinen-Babies waren echt. Es sei denn, ich brach ab.
Julius schenkte gerade Tee ein. »Ich höre stets zu. Es
sieht nicht immer so aus, aber…« Er reichte mir eine Tasse.
»Du nimmst nie Zucker.« Bei ihm und Anka hatte ich nie
Zucker nehmen dürfen. »Du willst bleiben, Harriet, und um
halb zwei heute nacht gehen. Kekse?« Er bot die Büchse an.
»Ich frage nicht nach dem Grund. Das ist dein Problem.«
Ich lachte. Wie recht er hatte! Ich nahm einen Keks. Gekauft. Anka
hatte sie immer selbst gebacken. Wie ich dort so saß,
vermißte ich Anka. Wie mußte er sich wohl
fühlen?
»Halb zwei, weil ich jeden Vorteil brauche, und ich
möchte um zwei bei Brandt sein, wenn sie wenig Widerstand
leisten. Krankenhausärzte nennen sie die Sterbestunde, aber ich
schwöre, das kommt ihnen bloß so vor, weil sie dann ihren
Hintern hochbekommen müssen. Der Nachtdienst sollte ausnahmslos
in der Personalkantine und mit Pokerspielen stattfinden.«
»Du redest dummes Zeug, Harriet.« Er lehnte sich
zurück, rührte in seinem Tee und beobachtete mich. »Du
redest dummes Zeug.«
Er hatte recht, also berichtete ich ihm statt dessen von Annie,
und zwar so viel wie nötig, daß
Weitere Kostenlose Bücher