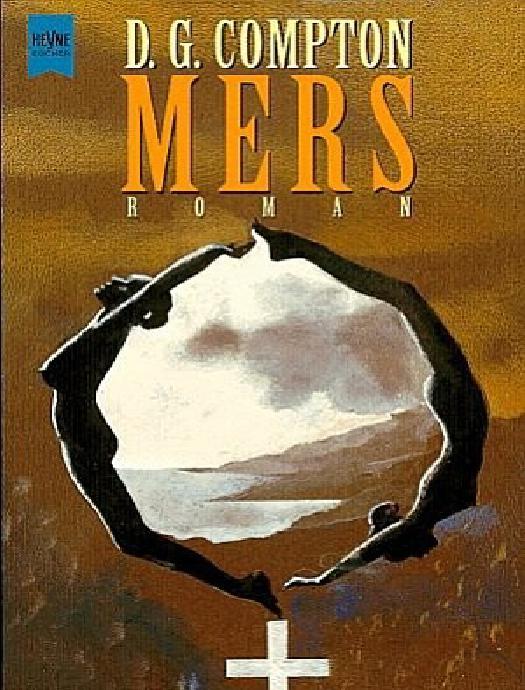![MERS]()
MERS
er Verständnis
aufbrachte. Ich wurde von einem rostigen Geklapper unterbrochen. Wir
hatten Polly vergessen. Sie steckte in ihrem Käfig unter ihrer
grünen Decke, und wir hatten sie aufgeweckt. Heftig
protestierend schlug sie mit ihrer Sitzstange gegen die
Käfigstangen. Julius entfernte die Decke, und sie hörte auf
damit. Sie war nicht sichtbar älter geworden und ebenso
abstoßend wie früher. Sie fixierte mich mit einem
orangefarbenen Auge und knirschte mit dem Schnabel.
»Sie mag dich«, meinte Julius. »Sie hat noch immer
kein Ei gelegt.«
Ich berichtete ihm von Annie, von Oswald Marton, von Sergeant
Milhaus und von der kosmischen Ordnung. Er wünschte mir
Glück und erzählte mir von einem Mädchen unten auf der
Parade, das er unterrichtete. Sie hatte Talent, jedoch, wie ich auch,
lediglich Fingerfertigkeit. Er schlug vor, ich solle für ihn
spielen, und danach weigerte ich mich, also spielte er statt dessen.
Er verspielte sich, doch es war nicht bloß
Fingerfertigkeit.
Wir aßen ein Abendbrot aus einem Geschäft,
Fertiggerichte, die Anka verabscheut hätte. Ich ging nach oben,
mich ausruhen, wählte eines von mehreren feuchten Schlafzimmern
und schlief auf der Stelle ein. Um ein Uhr fünfundzwanzig
erwachte ich auf eine kosmisch geordnete Weise, wusch mich,
pißte und ging nach unten. Ich hatte die Möglichkeit einer
Schwangerschaft nicht ernst genommen, sonst hätte ich einen
Urintest dabei gehabt. Warum hatte ich sie nicht ernst genommen? Ich
hätte sie ernst nehmen sollen. Nicht, daß in der
kosmischen Ordnung Wissen oder Unwissen einen Unterschied bedeutet
hätte.
Julius war im Wohnzimmer und hörte wieder Palestrina. Ich
schaute hinein, und er lächelte und winkte. Er war ein alter
Mann und allein, wirkte jedoch nicht einsam.
Das Eckert knirschte frostig unter einem klaren, mondlosen Himmel.
Das ›Schuhu‹ einer kleinen Eule. Wellen auf den Felsen
unterhalb des Schulhofs, doch bestanden sie nur in meiner Einbildung.
Das Mädchen und sein Bruder, die im Wind sangen.
In der Stille verursachte der Wagen einen Lärm wie
Kanonendonner, Schreie, Maschinengewehre. Langsam fuhr ich den
Hügel hinab, rollte im Leerlauf über das Grundstück,
die Hafenstraße hinab, verließ sie am Town Quay und fuhr
am Cafe ›Zum Neuen Jahrhundert‹ und dem Bahnhof
vorüber. Die Stadt war wie ein Geschäft voller Puppen, die
in ihren Schachteln lauschten. Wenn ich zuviel Lärm machte,
würden sie sich auf mich stürzen.
Marks K.O.-Aerosol lag auf dem Beifahrersitz neben mir, aber ich
hatte die Schutzkapseln nicht eingenommen.
Brandt International war hell erleuchtet: eine vier Meter hohe
Mauer, glatt wie Glas, Bogenlampen, Kameras, ein einziger Zugang, ein
Wachraum mit zwei stämmigen NatSich-Frauen. Hinter mir, zur
Straße hin, eine niedrige Brüstung, und in der Dunkelheit
dahinter der Fluß, schwach von Sternen erhellt. Brandt hatte
seit Papas Zeiten Fortschritte gemacht. Das Zentrum war in den Berg
hinein gebaut worden, tief im Fels verankert. Ein zwei Stockwerke
hoher Turm, vollgepfropft mit Hochsicherheits-PTG-Labors, ein hohes
Gewächshaus, um darin geklontes Gemüse zu ziehen, ein
Computer-Zentrum, unterirdische Delphin-Verschläge, und an einer
Seite zog sich ein geschwungener Büroflügel entlang. Die
Delphin-Verschläge hatten Brandts Primaten-Anlage ersetzt. Wie
diese befanden sich jene unter der Erde. Wissenschaft war hier nicht
vonnöten – sowohl Primaten als auch Meeressäuger
gedeihen unter natürlichem Tageslicht. Aber die Primaten waren
begraben worden, und jetzt wurden die Delphine begraben.
Ich parkte unseren Saab-Honda innerhalb des gelben Bereichs des
Personalparkplatzes. Ich nahm meinen Aktenkoffer – darin waren
Notizzettel, Tabellen, Farbstifte, ein überzeugendes
Durcheinander von Siebensachen, die man zum Forschen benötigte.
Ich zögerte, ließ dann das Aerosol auf dem Sitz liegen.
Der Ort wirkte verlassen – ich fand die Vorstellung
unmöglich, daß ich die Empfangsdame mit Nervengas
behandelte. Ich stieg aus dem Wagen und ging zum Wachraum von NatSich
hinüber. Der Frost biß, und ich zitterte. Ich
verschloß den Wagen nicht: NatSich-Richtlinien verboten
das.
Die Wächterinnen verstanden ihren Job. Eine blieb drinnen,
hinter Panzerglas, den Blick auf ihre Überwachungsmonitore
gerichtet. Die andere isolierte mich in ihrer
›Luftschleuse‹ und überprüfte mich auf Metall,
Sprengstoffe, Waffen aus Kunststoffgemisch. Der Name auf ihrem
NatSich-Schildchen lautete Renée. Sie ließ
Weitere Kostenlose Bücher