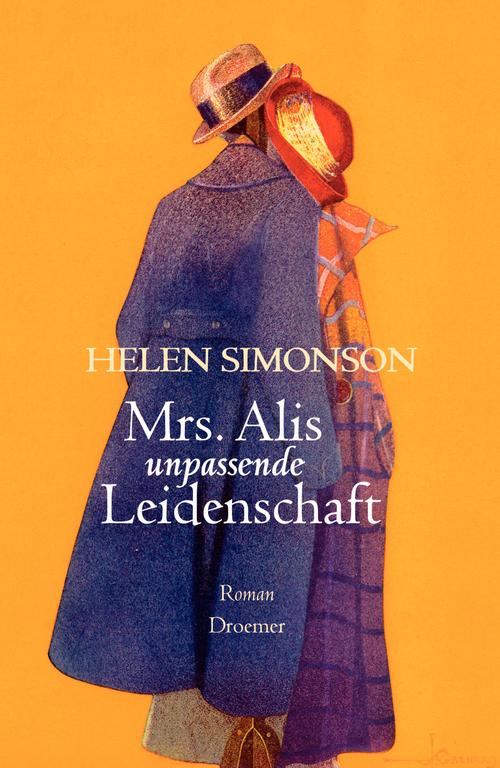![Mrs. Alis unpassende Leidenschaft]()
Mrs. Alis unpassende Leidenschaft
Kipling-Buch darzulegen, mit dessen Lektüre sie gerade fertig geworden sei. Sonntagnachmittags hatte der Laden geschlossen, und ihr Neffe war es, wie sie andeutete, gewöhnt, dass sie dann immer ein paar Stunden für sich blieb. Der Major hatte in bewusst beiläufigem Ton geantwortet, dass ihm Sonntagnachmittag aller Wahrscheinlichkeit nach passe und dass er dann unter Umständen auch eine Tasse Tee oder dergleichen machen werde. Sie erwiderte, sie werde gegen vier Uhr kommen, falls es ihm recht sei.
Natürlich stellte sich sofort heraus, dass die Tülle der dicken weißen Steingutkanne an einer Stelle hässlich abgeschlagen und trotz wiederholten Scheuerns innen nicht sauber zu kriegen war. Ihm wurde klar, dass die Beschädigung schon eine ganze Weile bestanden haben musste und er scheinbar die Augen davor verschlossen hatte, um keine neue auftreiben zu müssen. Vor zwanzig Jahren hatten Nancy und er über ein Jahr lang nach einer schlichten Kanne gesucht, die die Hitze speicherte und beim Ausgießen nicht tropfte. Er überlegte, ob er an einem der verbleibenden Tage in die Stadt fahren sollte, aber er wusste jetzt schon, dass unter den Unmengen von Teekannen, die in Geschäften für »Home Design« wie Pilze aus dem Boden schossen, nichts zu finden war. Er hatte sie förmlich vor Augen: Kannen mit unsichtbaren Henkeln, Kannen mit Vogelpfeifen, Kannen mit verschwommenen Abbildungen von schaukelnden Damen, Kannen mit verschnörkelten, wackeligen Henkeln. Schlussendlich entschied er sich dafür, den Tee in der Silberkanne seiner Mutter zu servieren.
Die schlichte, schön bauchige Kanne, deren Deckel ringsum ein schmales Band von Akanthusblättern zierte, ließ seine Teetassen sofort klobig und derb wie Bauern wirken. Ihm kam der Gedanke, das gute Porzellan zu benutzen, aber er hatte das Gefühl, alles andere als locker zu wirken, wenn er ein Tablett voller feinem Porzellan mit Goldrand ins Zimmer trug. Dann waren ihm Nancys Tassen eingefallen. Es waren nur zwei, vor der Hochzeit auf dem Flohmarkt gekauft. Nancy hatte die ungewöhnlich großen blau-weißen Tassen, die wie auf dem Kopf stehende Glocken aussahen, und die dazugehörigen, tief wie Schüsseln geformten Untertassen sehr bewundert. Sie waren sehr alt, stammten aus der Zeit, als die Leute den Tee noch in die Untertasse gossen und dann tranken. Nancy hatte sie günstig bekommen, weil sie nicht völlig gleich aussahen und es keine weiteren passenden Teile gab.
Eines Nachmittags machte sie ihm darin Tee, einfach Tee, den sie vorsichtig zu dem kleinen Kiefernholztisch vor dem Fenster in ihrem Zimmer trug. Ihre Vermieterin hatte sich durch seine Uniform und seine ruhige Art davon überzeugen lassen, dass er ein Gentleman war, und erlaubte ihm den Aufenthalt in Nancys Zimmer, solange er bei Einbruch der Nacht verschwand. Sie waren es gewohnt, sich im hellen Licht der Nachmittagssonne zu lieben und ihr Kichern unter der gebatikten Tagesdecke zu dämpfen, wenn die Zimmerwirtin draußen vor der Tür die Holzdielen absichtlich zum Knarzen brachte. An diesem Tag aber war das Zimmer aufgeräumt, die sonst herumliegenden Bücher und Farben waren verstaut und Nancys Haare zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden. Die wunderschönen, durchscheinenden Tassen, deren altes Porzellan die Hitze speicherte, ließen den billigen Tee bernsteinfarben leuchten. Mit langsamen, zeremoniellen Bewegungen goss sie ihm vorsichtig, um nichts zu verspritzen, aus einem Schnapsglas Milch ein.
Als er die Tasse hob, erkannte er mit einer plötzlichen Klarheit, die ihm weniger Angst einjagte, als er erwartet hatte, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, ihr einen Antrag zu machen.
Die Tassen zitterten in seinen Händen. Er bückte sich und stellte sie vorsichtig auf die Küchentheke, wo sie angemessen sicher standen. Nancy war immer ganz unbekümmert mit ihnen umgegangen; manchmal hatte sie wegen ihrer lustigen Form Blanc manger darin serviert. Sie wäre die Letzte gewesen, die darauf bestanden hätte, sie wie ein Relikt zu behandeln. Doch als er nach den Untertassen griff, hätte er sie am liebsten gefragt, ob es in Ordnung sei, sie zu benützen.
Er hatte nie zu denen gehört, die glaubten, dass sich die Verstorbenen herumtrieben, Genehmigungen erteilten oder allgemeine Wachhundfunktionen ausübten. Wenn in der Kirche die Orgel anschwoll und der Refrain des Lieds lästige Nachbarn in eine kurzlebige Gemeinschaft erhobener Herzen und schlichter Stimmen verwandelte, akzeptierte er, dass sie
Weitere Kostenlose Bücher