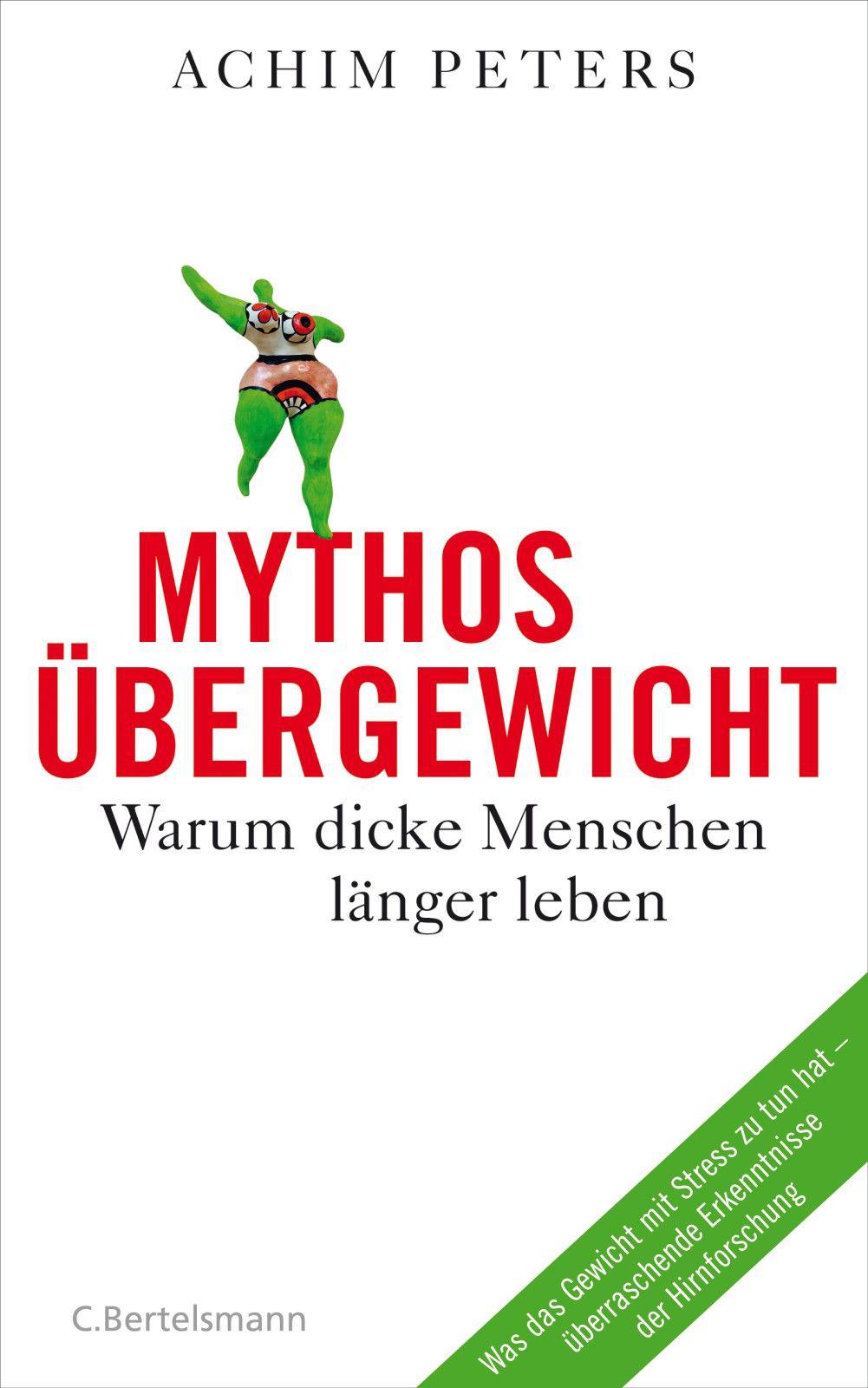![Mythos Übergewicht: Warum dicke Menschen länger leben. Was das Gewicht mit Stress zu tun hat - überraschende Erkenntnisse der Hirnforschung (German Edition)]()
Mythos Übergewicht: Warum dicke Menschen länger leben. Was das Gewicht mit Stress zu tun hat - überraschende Erkenntnisse der Hirnforschung (German Edition)
beziehungsweise Drogenmissbrauch geben.
Ich möchte an dieser Stelle aber ausdrücklich vor allzu schnellen Einschätzungen und Rückschlüssen warnen – familiärer Stress kann sehr vielfältig sein. Zum Teil liegen die Ursachen auch außerhalb der Familie (etwa in der Schule), und meistens führt das Zusammenwirken verschiedener Stressoren dazu, dass der Körperumfang wächst. Richtig ist, dass ein großer Körperumfang bei Kindern auf starke (und möglicherweise unerkannte) Stressoren im Umfeld hindeutet. Ein fataler Fehler wäre es aber, hieraus einen eindeutigen Hinweis auf Vernachlässigung oder Missbrauch abzuleiten.
Warum es so wichtig ist, Kindern den Stress zu nehmen, statt sie mit Diäten zu quälen
Wie bei Erwachsenen gibt es also auch bei Kindern unter dem Einfluss von toxischem Stress im Wesentlichen zwei Möglichkeiten der Reaktion: ein Leben mit einem hochaktiven Stresssystem oder eine Anpassung, mit der Folge von Gewichtszunahme (es gibt prinzipiell noch die Möglichkeit, Hirn- und Körperfunktionen deutlich runterzufahren und somit Leistungseinbußen und Erschöpfungszustände in Kauf zu nehmen – diese Möglichkeit findet sich aber meist als Ergänzung zu den beiden Hauptreaktionsformen). Aus medizinischer Sicht ist die Anpassung mit vermehrter Nahrungsaufnahme durchaus als Schutzstrategie des Gehirns unter stressvollen Lebensbedingungen zu bewerten – auch bei Jugendlichen und Kindern. Vor diesem Hintergrund sind alle Forderungen, dicke Kinder mit Diäten schlank zu machen, nicht nur widersinnig, sondern sogar bedrohlich. Kalorienentzug macht ein dickes Kind eben nicht gesund und schlank, sondern schlank, aber doppelt-gestresst – mit allen negativen Auswirkungen, über die ich bereits berichtet habe.
Wenn ich in Vorträgen über dieses Thema spreche, kommt häufig der Einwand, dass viele Kinder und Jugendliche auch in früheren Jahrhunderten großem psychosozialen Stress ausgesetzt waren, die weltweite Problematik »übergewichtiger Kinder« aber erst seit einigen Jahrzehnten auftritt. Um diesen Effekt zu verstehen, lohnt es, sich die Entwicklungen in den Schwellenländern wie zum Beispiel Brasilien oder Indien anzuschauen, die in den vergangenen Jahren große wirtschaftliche Fortschritte gemacht haben. Solange in diesen Ländern aber noch Nahrungsknappheit herrschte, hatten die gestressten B-Typen – insbesondere dann, wenn sie in armen Verhältnissen lebten – schlicht nicht die Möglichkeit, mehr zu essen, um so – bei habituiertem Stresssystem – ihren Hirnstoffwechsel zu stabilisieren. Deshalb haben wahrscheinlich Menschen vom Typ B unter derartigen Umständen die schlechtesten Überlebenschancen. Typ A hingegen, der bei Stress Gewicht abnimmt, hat einen geringeren Energiebedarf (ist sozusagen die ökonomischere Stressvariante) und ist daher bei Nahrungsmangel gegenüber Typ B im Vorteil. Die Situation ändert sich, wenn ab einem bestimmten Punkt der ökonomischen Entwicklung eines Landes die Nahrungsverfügbarkeit ausreicht, um die gesamte Bevölkerung zu versorgen – so war es in allen Industrienationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo es früher noch zu Versorgungskrisen oder sogar zu Hungersnöten kam, steht jetzt selbst für die Ärmeren, ja sogar für die Ärmsten genug kaloröse Nahrung zur Verfügung. Jetzt können Typ-B-Menschen von ihrer energie-kostspieligen Überlebensstrategie der Stresshabituation profitieren. Das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem die Gewichtszunahme vor allem bei Kindern und Jugendlichen der ärmeren Bevölkerungsschichten geradezu explodiert. Vor allem in den Großstädten Indiens und Brasiliens lässt sich dieses Phänomen seit einigen Jahren beobachten. Anders gesagt: In früheren Epochen (und in vielen stressvoll-unsicheren Gegenden der Welt gilt das bis heute) wurden arme Menschen nicht dick, weil sie gar nicht dick werden konnten. Es war einfach nie genug zu essen da.
Abb. 8: Diskriminierung im Namen der Gesundheit?
Im US-Bundesstaat Georgia sorgt eine Aufklärungskampagne mit Motiven wie diesem für heftige Diskussionen. Gezeigt werden Bilder von starkgewichtigen Kindern, die mit Warnhinweisen versehen sind, wie man sie in ähnlicher Form und Aussage sonst auf Zigarettenschachteln findet: »Moppelige Kinder werden ihre Eltern wahrscheinlich nicht überleben« oder »Fette Kinder werden fette Erwachsene«. Vor allem bei Amerikanern, die selbst dick sind, wird diese Art der »Aufklärung« als Diskriminierung empfunden. Die Initiative
Weitere Kostenlose Bücher