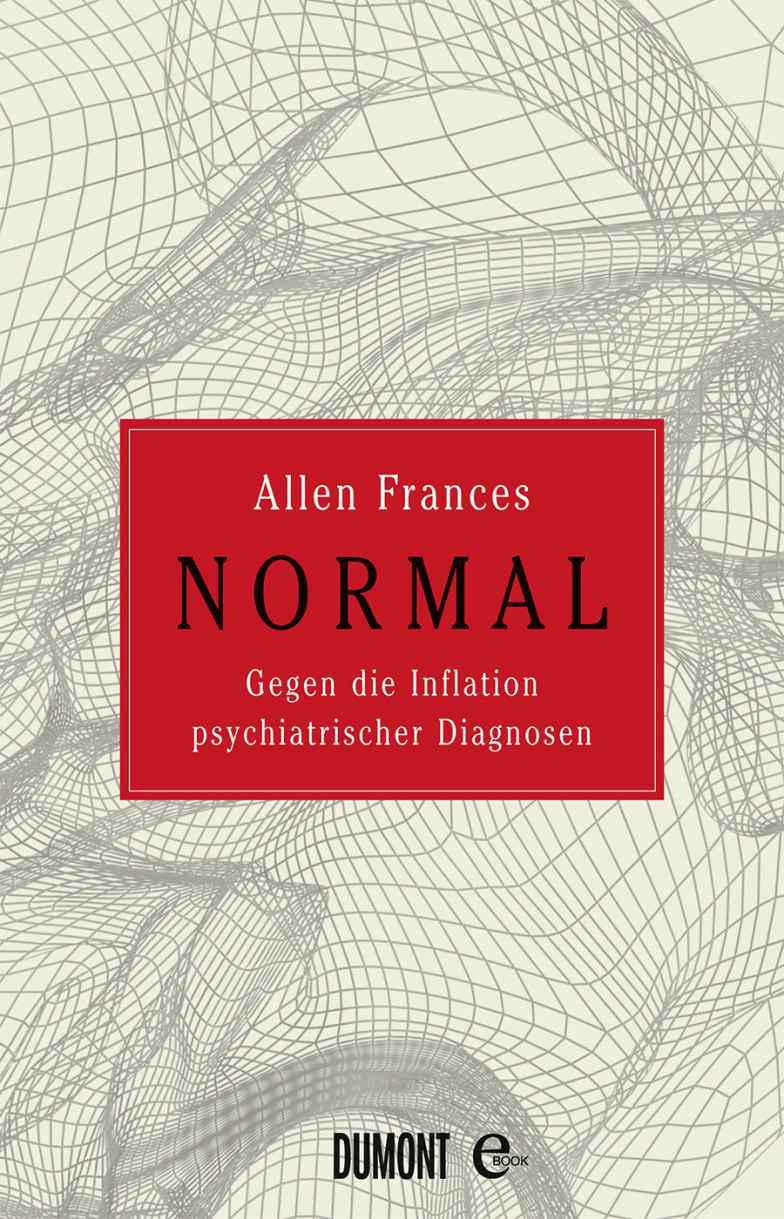![Normal: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen (German Edition)]()
Normal: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen (German Edition)
regelrecht explodiert, natürlich dank tatkräftiger, aber irreführender Pharmawerbung. Dr. A. war darauf hereingefallen und sah überall bipolare Störungen, wo keine waren. So funktionieren Moden. Sicher wäre Dr. A. vorsichtiger gewesen, hätte sie vorhergesehen, welchen anhaltenden Schaden ihre Diagnose anrichtete.
Das erste Opfer war Susans Selbstwertgefühl. »Dieser neue Aspekt meiner Identität machte mir schwer zu schaffen. Ich fühlte mich nicht mehr normal. Was für irre Dinge habe ich getan? Dass ich manisch-depressiv bin, muss den Leuten doch aufgefallen sein, nachdem Dr. A. nur ein paar Minuten gebraucht hatte, um darauf zu kommen. Ich fürchtete mich vor dem Tag, an dem mein Sohn es erfahren würde. Er hatte eine bessere Mama verdient, eine normale – eines Tages würde ihm klar werden, dass er auch nicht normal war.« Und wie sollte sie je wieder schwanger werden? Die Einnahme der Tabletten abzubrechen, hätte einen Rückfall in die »bipolare Störung« ausgelöst, und sie weiter zu nehmen, hätte dem Baby geschadet.
Zum Glück ging Dr. A. in Pension. Die neue Psychiaterin war äußerst skeptisch bezüglich dieser Diagnose und meinte dazu, für Dr. A. sei die gesamte Menschheit bipolar. Susan setzte nach und nach alle überflüssigen Medikamente ab, und eine gewaltige seelische Last war von ihr genommen. Bald wurde sie wieder schwanger und bekam einen zweiten Jungen, der ein sehr pflegeleichtes Kind war. Die postnatale Depression blieb aus.
Es sollte ein Happy End sein, ist aber keines. Die Diagnose »bipolare Störung« stirbt einfach nicht, sie steht in Susans Akten und spukt noch immer in ihrem Leben herum. Zuerst war es die Lebensversicherung, die sie zugunsten ihrer Kinder abschließen wollte, falls ihr etwas zustieße. Sie wurde von vier Versicherern abgelehnt und erfuhr, dass bipolar Gestörte als gefährlich gelten. Dann erfuhr sie, dass sie kein Kind adoptieren kann. Susan und ihr Mann wären ideale Kandidaten gewesen – sie führen eine liebevolle Ehe, sind beide gebildet, haben feste Jobs und ein eigenes Haus, sind hoch motiviert, stabil, mitfühlend und so weiter und so fort. »Obwohl wir so viele Pluspunkte vorzuweisen hatten, erfuhren wir, dass wir wegen meiner Diagnose niemals eine Chance hätten.«
Das Patientenrechtegesetz sieht vor, dass unzutreffende Diagnosen korrigiert werden müssen, doch das Krankenhaus hat sich bis dato geweigert, den diagnostischen Fehler zuzugeben, obwohl Stellungnahmen anderer Psychiater vorliegen, die klar bestätigen, dass Susan nicht unter einer bipolaren Störung leidet. Zumindest eine Wolke hat sich verzogen: »Als meine Psychiaterin sagte, ich sei die beste Mama für meine Kinder, war ich erst mal sprachlos. Natürlich habe ich meine Fehler, aber ich bin dankbar und stolz, dass ich die Mutter meiner zwei kleinen Wunder bin. Und ich lasse nicht locker, bis meine Akten korrigiert sind.«
Die Geschichte lehrt uns mehrerlei. Moden führen zu unbedachten Diagnosen. Kliniker sollten sich Moden widersetzen; auf keinen Fall dürfen sie sich ihnen anschließen. Falsche Diagnosen können dauerhaften Schaden anrichten, für den es kein natürliches Verfallsdatum gibt. Und Ärzte sollten Empfehlungen von Pharmavertretern niemals für bare Münze nehmen.
Liz’ Geschichte: Die Modediagnose bipolare Störung im Kindesalter und ADHS
Liz ist dreiundzwanzig, eine im Großen und Ganzen zufriedene Frau, die jetzt ein Leben im öffentlichen Dienst begonnen hat, gewürzt mit ausgiebigen Reisen und liebevollen Beziehungen. »Ich habe meine Höhen und Tiefen wie alle anderen auch, und ich glaube nicht, dass ich darum irgendwie verrückt bin. Aber bis ich das sagen und auch wirklich glauben konnte, hat es ewig gedauert.«
Liz war ein schwieriges Kind – hyperaktiv, zu Wutanfällen und Machtkämpfen neigend. Ein neuropsychologischer Test im Alter von fünf ergab einen hohen IQ – aber die Diskrepanz zwischen ihren verbalen und ihren sonstigen Leistungen wurde als Hinweis auf eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung und eine Lernbehinderung gewertet. Ritalin verbesserte zwar ihre Handschrift, hatte aber beunruhigende Nebenwirkungen – einen ticartigen Husten, Zwangshandlungen und Depression.
»Mit sechs Jahren ging ich manchmal in die Küche und hielt mir ein Fleischmesser an die Kehle – nicht, um mich tatsächlich aufzuschlitzen, es war eher so, dass ich wissen wollte, was passieren würde, wenn ich es tat. Als ich das meiner Mutter gestand, ging
Weitere Kostenlose Bücher