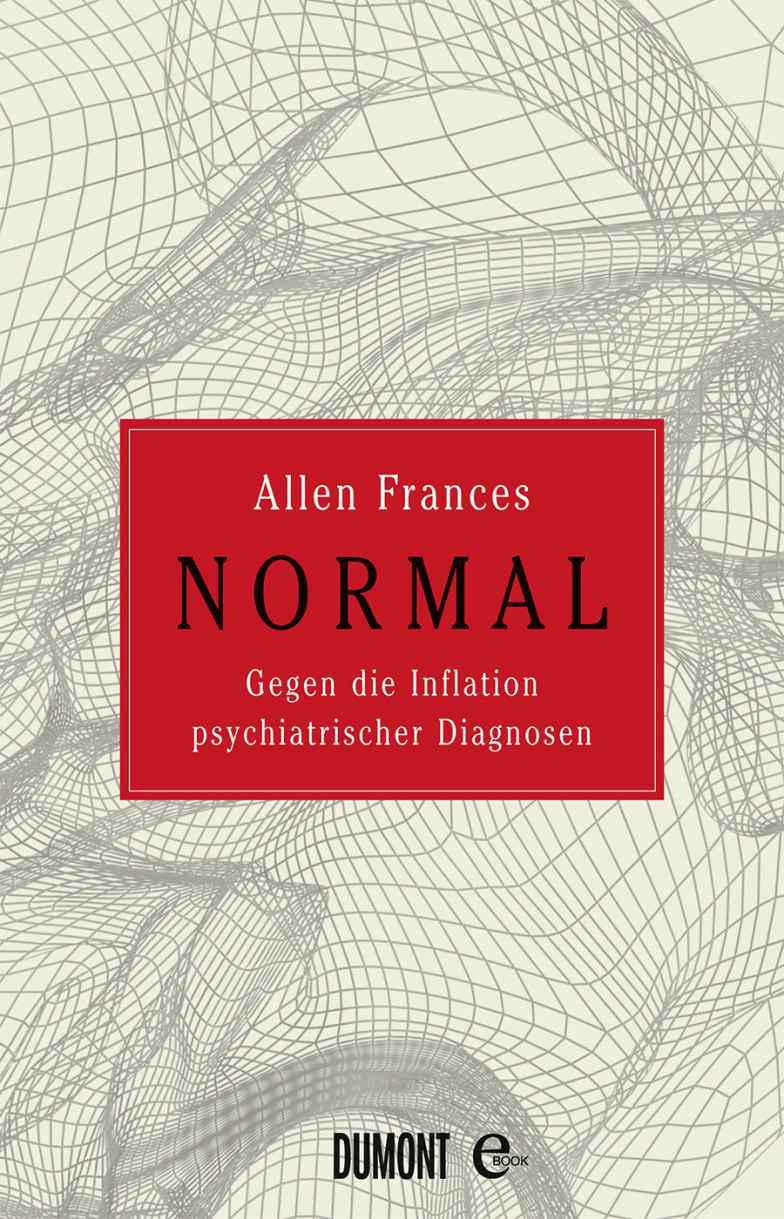![Normal: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen (German Edition)]()
Normal: Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen (German Edition)
Klassenbeste.
Cleos Eltern waren beide Professoren libanesischer Herkunft, die nach Australien eingewandert waren, als Cleo ein Kleinkind war. Sie fühlten sich von ihrer Tochter überfordert; sie stellten ein Kindermädchen ein, dessen einzige Aufgabe es war, das Kind in die Schranken zu weisen, und beschlossen, keine weiteren Kinder zu bekommen. »Ich wurde nicht untersucht, weil meine Eltern aus einem kulturellen Vorurteil heraus psychische Krankheiten nicht akzeptierten, und die Schule war zufrieden, weil ich ja sehr gut war. Außerdem wussten sie dort nicht mal, wie eine normale Araberin ist, geschweige denn eine unnormale.«
Schlimmer wurde es allerdings, als Cleo fünfzehn war: Sie wurde depressiv, zweifelte an sich, fürchtete schulisches Versagen, fühlte sich von ihrer Familie abgeschnitten, war ohne Freunde, hatte Selbstmordgedanken. »Meine Eltern wiesen die Vorstellung einer psychischen Krankheit wieder weit von sich, und ich musste allein damit zurechtkommen. Dass ich so behütet aufwuchs, machte mich verletzlich, ich war nicht vorbereitet auf eine Welt, die so grausam schien. Allein der Anblick glücklicher Menschen ließ mich in Tränen ausbrechen, so sehr sehnte ich mich danach, wie sie zu sein.«
Trotz ihres inneren Aufruhrs schloss Cleo die Highschool ein halbes Jahr früher ab als geplant und begann mit dem College – sie wählte Psychologie als Hauptfach, weil sie hoffte, irgendwann besser zu verstehen, was mit ihr los war, und dann anderen helfen zu können. Aber mit siebzehn war sie dazu nicht bereit. »Schluss war’s mit meinen erstklassigen Noten! Auf einmal war alles viel schwieriger – zum ersten Mal in meinem Leben war ich eine mittelmäßige Studentin, ich ließ mich von jeder Kleinigkeit ablenken, und meine Gedanken sprangen von einem Thema zum nächsten. Zum Beispiel fing ich an, mitzuschreiben, dann fiel mir auf, dass der Dozent ein neues Dia eingelegt hatte, ich stockte mitten im Satz und wusste nicht mehr, was er eine Minute zuvor gesagt hatte. Ich schaffte es kaum, eine Seite fertig zu lesen, ehe ich wieder vergessen hatte, um was es überhaupt ging, und ich musste mir ein Lineal unter jede Zeile legen, weil ich ständig die Stelle verlor, an der ich war. Ständig kamen mir neue Gedanken, und ich sprang immer wieder auf, um irgendwas zu tun, bis mir wieder einfiel, dass ich ja lesen sollte. Ich konnte mich noch so sehr bemühen – die Noten, an die ich gewöhnt war, schaffte ich einfach nicht mehr. Ich fühlte mich als Versagerin.«
Cleo wurde zur Therapie überwiesen, mochte aber ihren Therapeuten nicht. »Ich fand den Mangel an Klarheit in meiner Diagnose und der Diskussion darüber völlig inakzeptabel und frustrierend. Ich verstand das Chaos nicht, das meine Störung verursachte, und war aber überzeugt, dass ich wissen müsste, was meine Krankheit ist, sonst könnte man sie nicht behandeln.«
Cleo holte sich eine zweite Meinung, und der neue Therapeut erklärte ihr, was ADHS ist und inwieweit die Störung ihr Leben beeinflusste. »Eine eindeutige Diagnose zu haben war eine enorme Erleichterung, ich hatte das Gefühl, endlich verstanden zu werden. Auch das Bewusstsein, dass ich nicht die Einzige war, der es so ging, und dass es nicht meine Schuld war, wenn bestimmte Eigenheiten an mir anderen Leuten auf die Nerven gingen, war geradezu eine Erlösung. Mein Therapeut half mir zu verstehen, was es heißt, ADHS zu haben, und machte mich mit vielen Strategien und Lerntechniken bekannt. Er lieh mir Bücher über ADHS und machte mich auf viele hilfreiche Webseiten aufmerksam. Ich begann zu recherchieren und machte mich mit meiner Krankheit vertraut, lernte meine Symptome besser kennen und mit ihnen umzugehen.«
Cleos Zustand verbesserte sich sehr, und sie schloss das College ab. Doch nach wie vor fiel es ihr schwer, sich zu konzentrieren, und sie begann Ritalin zu nehmen. »Das Resultat war umwerfend. Meine Aufmerksamkeitsspanne und Konzentration nahmen ungeheuer zu – auf einmal konnte ich drei Stunden lang am Computer sitzen und tippen, ohne unterbrechen zu müssen.« Cleo machte ihr Examen mit Bestnoten. »Nachdem ich zehn Jahre lang eine Diskrepanz zwischen meinen tatsächlichen Fähigkeiten und meinen Schul- bzw. Collegenoten erlebt hatte, hatte ich jetzt endlich das Gefühl, dass ich meinem Potenzial gerecht wurde. Ich fühlte mich wieder wie ich. Die Kombination aus Medikament und Psychotherapie war perfekt für mich. Dass ich die richtige Diagnose bekam, hat mir
Weitere Kostenlose Bücher