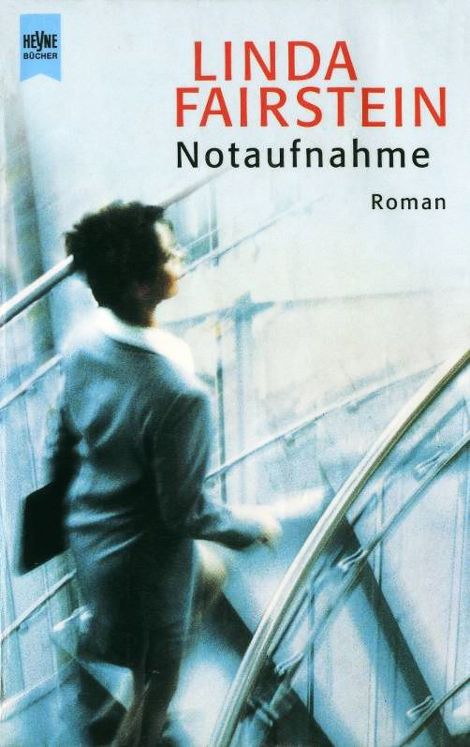![Notaufnahme]()
Notaufnahme
ihre fachlichen Qualitäten besteht gar kein Zweifel«, erwiderte Spector. »Mit ihr an der Seite fühlte ich mich im OP absolut sicher. Deshalb habe ich sie häufig gebeten, mir zu assistieren. Aber außerhalb des OPs reagierte ich allergisch auf sie. Sie ging sowohl mit den Studenten als auch mit den Kollegen überkritisch ins Gericht. Sie hat zweifelsohne Großes für dieses Krankenhaus und diese Universität getan, aber es war an der Zeit, dass sie sich verabschiedete. Ich will gar keinen Hehl daraus machen: Ich konnte es kaum erwarten, dass sie endlich ging – allerdings hätte ich sie lieber in der Concorde anstatt in einer Zinkwanne gesehen.«
Spector hatte uns nichts mehr zu sagen. Er erhob sich und teilte uns mit, er werde zu einer Besprechung erwartet.
Erst als sich die Türen des Aufzugs hinter uns geschlossen hatten, ergriff Mike das Wort. »Ich kann’s nicht glauben: Bill Dietrich. Bei der bloßen Vorstellung, wie morgens sein Bettlaken aussieht, wird mir schlecht: Pomade, Bräunungsmittel und all so ein Zeug. Der Mann hätte sich besser mit der Besitzerin eines Waschsalons eingelassen. Was wollte Dogen mit so einem Lackaffen?«
»Schwer zu sagen. Wie fandet ihr Spector?«
»Naja, er hat mit offenen Karten gespielt. Er schien ziemlich geradeheraus – nach dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung.«
Auf der Fahrt ins New York Hospital gingen wir gemeinsam jede seiner Äußerungen durch. Der Sicherheitsbeamte am Haupteingang erklärte uns den Weg zu Dr. Babsons Büro.
Auf mein Klopfen hin öffnete uns eine zierliche Frau um die fünfzig mit schulterlangem braunen Haar und sanften haselnussbraunen Augen.
»Ich bin Gig Babson. Katherine, um korrekt zu sein. Bitte kommen Sie rein.«
Ich war gespannt auf eine Beschreibung von Gemma Dogen aus weiblicher Sicht. Während Mercer uns vorstellte, warf ich einen kurzen Blick auf die Diplome an der Wand – Vassar College ‘69 und Harvard Medical School ‘73.
Gig Babson berichtete, wie sie Gemma Dogen kennengelernt hatte. »Es war erst vor drei Jahren. Wir haben uns bei der Arbeit kennen gelernt. Wir waren beide im selben Ärzteteam – es ging um die Trauma-Behandlung der kleinen Vanessa, vielleicht erinnern Sie sich?«
Natürlich erinnerten wir uns. Die Geschichte hatte keinen Menschen in New York unberührt gelassen. Bei dem Absturz eines Privatjets auf dem La Guardia-Flughafen waren acht Erwachsene ums Leben gekommen; einzige Überlebende war die damals vierjährige Vanessa, die aus dem Flugzeugwrack geschleudert worden und so dem Flammentod entkommen war, aber sechzehn Wochen im Koma lag. Ihre Verwandten hatten gefordert, die lebenserhaltenden Maschinen abzuschalten, da anscheinend keine Hoffnung mehr auf eine Heilung der schweren Hirnverletzungen bestand.
Doch ein aus Neurochirugen bestehendes Spezialteam – an einzelne Namen konnte ich mich nicht mehr erinnern – hatte so etwas wie ein medizinisches Wunder erreicht. Das Mädchen erwachte aus dem Koma und erlangte innerhalb weniger Monate ihre geistigen Fähigkeiten vollständig wieder. Das Bild von dem lächelnden Mädchen auf den Treppen des Mid-Manhattan, umringt von dem Ärzteteam, das ihm ein neues Leben geschenkt hatte, war allen, die es gesehen hatten, im Gedächtnis geblieben.
»Gemma war auf ihrem Gebiet einfach brillant. Sie war es, die Vanessas Leben gerettet hat. Sie entdeckte die Quetschung der vorderen Großhirnrinde, die ein massives Blutgerinsel verursacht hatte. Während wir anderen angesichts der Risiken einer Operation noch zögerten, krempelte Gemma die Ärmel hoch und entfernte den Bluterguss – mutig, ruhig und tadellos. Ohne Gemma wäre das Mädchen ein Pflegefall geblieben.«
»Wenn ich das höre, Doctor«, warf ich ein, »frage ich mich, warum jemand ein Interesse daran hatte, sie zu töten.«
»Glauben Sie wirklich, der Täter hat es gezielt auf Gemma abgesehen? Ich meine, ist sie nicht vielmehr zufällig einem Obdachlosen oder einem Einbrecher zum Opfer gefallen? An einen gezielten Mord habe ich bisher noch gar nicht gedacht. Wissen Sie, wir haben ihr immer wieder gesagt, dass sie verrückt sein müsse, nachts zu arbeiten, aber wir befürchteten natürlich, dass ihr auf dem Weg etwas zustoßen könne, nicht im Krankenhaus selbst. Aber sie ließ sich nicht beirren. Sie brauchte nicht viel Schlaf, und es war für sie das Normalste der Welt, nachts zu arbeiten und erst gegen drei Uhr morgens nach Hause zu gehen. Dann schlief sie ein paar Stunden, und noch vor
Weitere Kostenlose Bücher