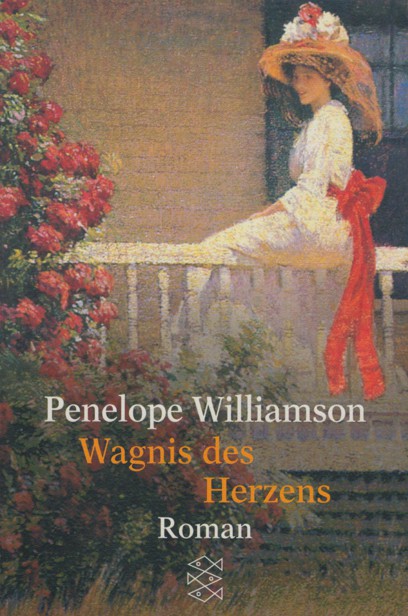![Penelope Williamson]()
Penelope Williamson
sein.« Sie
schnaubte. »Eine Frau fällt auf der Straße in Ohnmacht, und du bleibst stehen
und hilfst ihr. Das allein ist schon ein Unding ... obwohl, warum ... trotzdem
..., aber diese Frau dann anschließend auch noch zu deiner Bekannten zu machen,
das ist wirklich die Höhe. Du bringst den armen Farbigen, die in Goree wohnen,
jeden dritten Sonntag im Namen der Kirche Wohltätigkeitsgeschenke, aber niemand
würde sich einfallen lassen, dich ins Haus zu bitten. Das tut man einfach
nicht.«
»Warum eigentlich nicht?«
Bethel
drehte sich um, und auf ihrem Gesicht lag ein seltsam gequälter Ausdruck. »Man
tut das nicht«, erklärte sie noch einmal mit Nachdruck, »denn die niederen
Klassen haben gelernt, bescheiden Distanz zu uns, der guten Gesellschaft, zu
wahren. Und das ist auch richtig so!«
»Vielleicht
laden sie uns nicht ein, weil sie uns für langweilige Snobs halten. Und damit
haben sie recht!« Sie räusperte sich und sagte dann entschieden: »Mrs. McKenna
hat mich zweimal sehr freundlich eingeladen, und ich habe die Einladung
angenommen. Sie ist eine respektable verheiratete Frau ...«
»Respektabel? Sie ist eine Irin!«
Emma legte
die Haarbüste auf den Frisiertisch und griff nach der Dose mit den Haarnadeln.
Sie schob die Haare nach oben und ordnete sie am Hinterkopf zu einer glatten
Rolle, um sie dort festzustecken. Aber sie zitterte so sehr, daß der
Seidenkimono in Bewegung geriet. »Ich werde Geoffrey nach seiner Meinung fragen«,
sagte sie schließlich und brachte damit wieder einmal ihre neu entdeckte Macht
als Geoffrey Alcotts Verlobte ins Spiel und als die einzige Hoffnung der
Tremaynes. »Er zumindest scheint zu billigen, was ich mache.«
Geoffrey würde ihren Besuch bei dieser Frau natürlich
nicht billigen. Auch wenn sie manchmal glaubte, ihn nur sehr wenig zu kennen,
soviel wußte sie: Ihr Verlobter hatte sehr klare Vorstellungen von seinem Platz
in der Welt und der richtigen Ordnung der Dinge. Er schätzte es nicht, wenn
diese Ordnung in Frage gestellt oder gestört wurde.
Emma riskierte im Spiegel einen
Blick auf ihre Mutter. Bethel hatte die Finger um die glitzernde Jetthalskette
geschlungen und starrte auf die großen Rosen im Teppich.
Sie schien mit sich selbst zu
sprechen, als sie flüsterte: »Gerede ... sie werden wieder über uns reden, wie
damals auf dem Ball. Und was wird geschehen, wenn sie dahinterkommen? Sie
dürfen nicht dahinterkommen ...«
»Wie bitte?
Was meinst du?« Emma hatte ihre Mutter noch nie so geistesabwesend gesehen.
Aber in letzter Zeit nahm sie auch von Maddies Chloralhydrat. Sie behauptete,
das Mittel zügle den Appetit. »Mama? Geht es ... dir gut?«
Bethel zuckte zusammen und
drehte sich energisch um. »Vergiß es«, sagte sie mit einer knappen
Handbewegung. »Vergiß es.«
Emma stieß
langsam und zitternd den Atem aus. Sie wußte selbst nicht genau, wieviel von
dem, was sie gesagt hatte, reiner Bluff war. Aber das mußte sie auch nicht
sofort herausfinden, denn ihre Mutter würde zunächst nichts davon in Frage
stellen.
Bethel schob die Schultern
zurück und kam zu ihrer Tochter. »Du meine Güte, laß mich das für dich machen«,
sagte sie und nahm ihr die Elfenbeinhaarnadeln aus der Hand. »Du bringst deine
Haare völlig durcheinander. Du weißt überhaupt nicht, was für ein Segen es ist,
so lange und dichte Haare zu haben. Alle anderen müssen sich mit Haarpolstern,
falschen Zöpfen und Haarteilen abmühen.«
Sie schob
die Nadeln so fest in Emmas Haare, daß sie die Kopfhaut traf. »Der arme Mr.
Alcott ist im Augenblick vielleicht bis über beide Ohren in dich verliebt, aber
man kann kaum von ihm erwarten, daß er dein exzentrisches Wesen bis in alle
Ewigkeit toleriert. Das wird auch die Gesellschaft nicht tun! Emma, ich
wiederhole noch einmal, halte dich an die Regeln. Es war schon immer schwierig,
dich soweit zu bringen, daß du dich deiner Stellung im
Leben gemäß verhältst. Du bist stundenlang allein in deinem Segelboot und denkst
nicht daran, daß du eine Tremayne und eine Dame der guten Gesellschaft von
Bristol bist. Mit zweiundzwanzig benimmst du dich noch immer wie ein
ungezogenes Mädchen. Und was du in der alten Orangerie machst ... in meinen
Augen ist das keine Kunst. Ganz bestimmt nicht! Es ist eine Schande.« Sie
verstummte und biß sich auf die Lippen. »Aber diese neueste Eskapade übersteigt
das Maß des Erträglichen. Du freundest dich mit einer Irin an ... einem
Niemand. Das ist ... einer Tremayne unwürdig ...«
»Es
Weitere Kostenlose Bücher