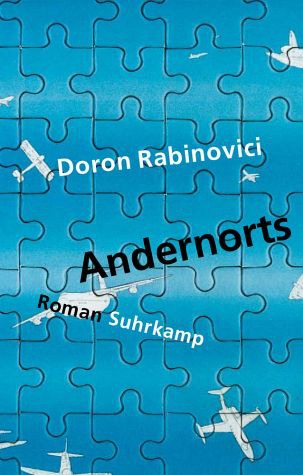![Rabinovici, Doron]()
Rabinovici, Doron
Mann sah ihn argwöhnisch an, als hätte er eben behauptet,
Nazis seien überaus liebenswerte Menschen und die ganze Geschichte von der
Verfolgung wäre nur ein Mißverständnis.
Ethan mußte an jenen Wiener
Taxler denken, der Noa und ihn einige Tage vorher zum Schwechater Flughafen
gebracht hatte. »Nach Israel? Ist die Lage dort denn sicher genug? Ich meine
nur. Wegen der Attentate.«
Noa daraufhin: »Taxifahren ist
gefährlicher.«
Der Zustand seines Vaters
hatte sich verschlimmert. Er lag vollkommen entkräftet da. Jede Bewegung war
ihm zuviel. Er keuchte. Sein Körper war besetztes Gebiet. Der Schmerz hatte ihn
okkupiert, saß ihm in den Gliedern. Vater und der Schmerz. Ein gegenseitiges
Belauern. Er wollte dennoch reden. Er gab nicht auf, blickte seinen Sohn
traurig an, als wolle er sich für sein Benehmen entschuldigen, als tue es ihm
leid, sein Kind seinetwegen leiden sehen zu müssen.
»Du hättest nicht wegen des
Nachrufs einen Streit beginnen dürfen.«
»Das ist jetzt unwichtig.«
»Du hättest einen Text für Dov
schreiben sollen. Nicht eine Polemik gegen den anderen. Eine Hommage. Er hätte
es verdient.«
»Ich konnte nicht.«
»Aber verstehst du nicht? Das
Gedenken wäre die bessere Antwort gewesen ... Ohne diesen anderen zu erwähnen.
Was soll der dir? Wenn Klausinger glaubt, Dov, dem Vertriebenen, so die Ehre zu
erweisen ... Soll sein. Was muß dich das stören?«
»Du hast dir sogar seinen
Namen gemerkt? Abba, denk nicht daran. Warum ißt du das Joghurt nicht? Und du
mußt dein Wasser trinken.«
Er wehrte das Glas ab, preßte
hervor: »Niemand hätte dir das übelgenommen. Deine Erinnerung an Dov ... Im
Gegenteil ... Aber jetzt ist er eine umstrittene Gestalt. Sein Leichnam, seine
Biographie ein Schlachtfeld. Und du hast das gemacht.«
»Hätte ich schweigen sollen?
Müssen wir uns auf den Kopf spucken lassen und dann sagen, daß es regnet?«
»Über Dov hättest du schreiben
müssen.«
»Hier, dein Joghurt.«
»Laß mich, ich kann nicht
mehr. — Es ist nicht zu spät dafür. Setz dich hin und schreib.«
»Ich will nicht. Die ganze
Debatte hängt mir zum Hals heraus.«
Sie sahen aneinander vorbei. Ethan
nahm die Schale und einen Teelöffel zur Hand. Der Kranke drehte das Gesicht
weg: »Dov war kein Rassist. Es ging ums nackte Überleben. Wir waren auf der
Flucht.«
Er löffelte dem Vater das
Essen in den Mund.
Aber nach dem zweiten Bissen
keuchte der: »Glaubst du, wir hatten eine andere Wahl? Es gab keinen Ausweg.
Wohin hätten wir denn sollen? Nach Auschwitz? Hätte ich im Lager bleiben
sollen?«
»Hier geht es nicht um
Auschwitz. Klausinger schrieb von Israel, von Dov, vom Kibbuz. Über das Land
der früheren arabischen Nachbarn ...«
»Sie waren geflohen. Wir haben
den Krieg nicht begonnen.«
Ethan wiederholte nur: »Es
geht nicht um Auschwitz.«
»Ich habe es geahnt. Insgeheim
gibst du denen recht. Ich kenne dich. Einen Sohn habe ich aufgepäppelt und
großgezogen ... Das eigene Fleisch und Blut ...«
Ethan schüttelte den Kopf,
aber er sagte nichts.
Von unten, im Liegen, sah
Felix Rosen auf seinen Sohn, der sich über ihn beugte und auf ihn herabblickte.
Felix Rosen sah sein Ende. Er würde bald nicht mehr sein. In ihm staute sich
das Gift. Sein Körper wurde geflutet. Ihm war nicht nur, als werde er in
Zukunft nicht mehr sein. Er schaute zu, wie alles, was er je gewesen war, ausgelöscht
wurde. Selbst seine Vergangenheit wurde nachträglich verfälscht und
vernichtet. Er war nicht als Zionist ins Land gekommen, sondern bloß mit
letzter Kraft. Viele im Displaced Persons Camp sprachen den ganzen Tag nur von
der Aussicht auf einen Judenstaat. Ihn hatte vor allern beschäftigt, nicht
zugrunde zu gehen. Ehe er an Bord eines illegalen Schiffs nach Palästina
aufgebrochen war, hatte er sich bemüht, ein Visum in die USA zu erlangen.
Vergeblich.
Damals war es noch kein
Verdienst gewesen, ein Opfer, ein Überlebender zu sein. Die Schmach der
Verfolgung haftete an ihm. Er stank nach Angst und Tod. Die Leute wollten
nicht hören, wie es ihm ergangen war. Keiner wollte wissen, wie er den Mördern
entronnen war. Niemand wagte zu fragen, wieso er nicht umgebracht und
verbrannt worden war, aber er fühlte, daß er unter Verdacht stand, allein weil
er noch existierte.
Kaum jemand hatte sich damals
für einen wie ihn, für den jungen Felix Rosen interessiert. Nicht die Amerikaner
und nicht die Russen. Aber Dov Zedek sehr wohl. Er hatte nach ihm gesucht, ihn
wiedergefunden und aus
Weitere Kostenlose Bücher