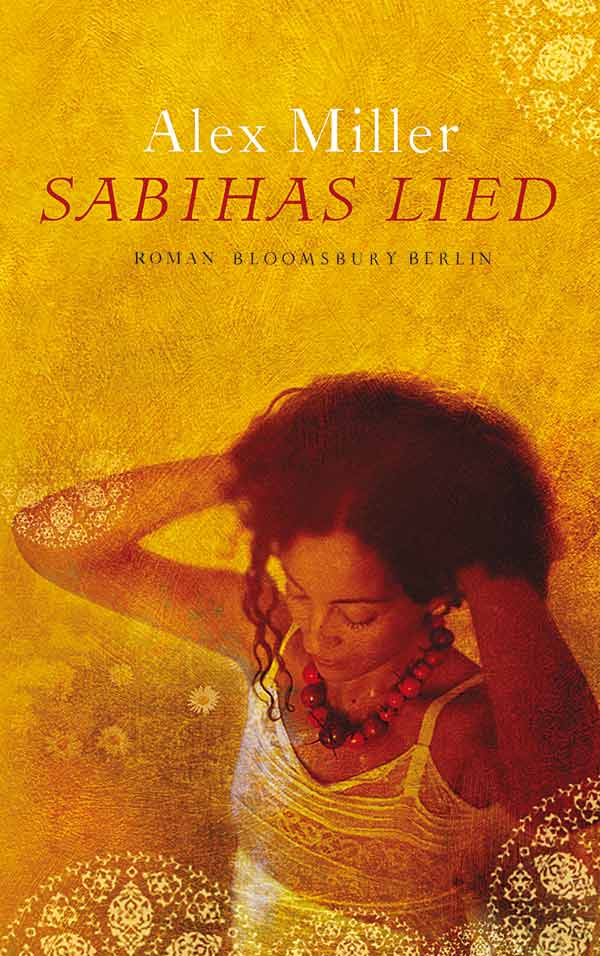![Sabihas Lied]()
Sabihas Lied
ein Stück Gebäck und setzte mich ans andere Tischende. Dort starrte ich an Clare vorbei durch die Hintertür auf unseren schmalen Garten, in dem ein einziger Baum stand, eine WeiÃbirke, die Marie und ich vor über zwanzig Jahren gepflanzt hatten. Mir fiel auf, dass die Trockenheit ihr allmählich zusetzte. Die Triebe starben langsam ab. Marie hatte den jungen Baum gehalten, während ich drum herum die Erde feststampfte. Das war kurz nach unserem Einzug. Clare war damals in ihrem letzten Highschool-Jahr. Ich warf ihr einen Blick zu. Beim Lesen machte sie kleine Geräusche, die je nach Artikel Verblüffung oder Widerwillen ausdrückten. Ohne den Kopf zu heben, fragte sie plötzlich ganz nüchtern und sachlich: »Hast du Mum eigentlich jemals betrogen?«
»Was soll das?« Ich nahm einen Schluck Kaffee. »Das geht dich nichts an.«
Sie legte die Zeitung aus der Hand und leckte sich den Honig von den Fingern. Dann sah sie mir in die Augen. »Das heiÃt also ja.«
»Nein. Ich habe deine Mutter nie betrogen.«
»Nie? Kein einziges Mal? Bist du dir da sicher? Komm schon, Dad. Du bist ein Mann, und Männer betrügen nun mal.«
»Wenn sie es tun, tun sie es mit einer Frau. Also betrügen Männer und Frauen gleichermaÃen.«
Clare gab mir mit einem verschwörerischen Lächeln zu verstehen, dass ich ihr meine heimlichen Freuden ungestraft anvertrauen dürfe, wenn mir danach sei.
»Kein einziges Mal«, sagte ich mit Nachdruck. Ich biss ein Stück Gebäck ab. »Wir beide werden noch kugelrund, wenn Sabiha die Oberhand behält.«
»Mum konnte einem manchmal ganz schön auf die Nerven gehen«, bemerkte sie.
Ich war erstaunt, das aus Clares Mund zu hören. Auch wenn sie sich als Teenager heftig mit ihrer Mutter gestritten hatte, war ihr Andenken für sie heilig. Ich hatte von ihr bisher noch nie die leiseste Kritik an Marie vernommen.
»Deine Mutter war eine starke Frau«, antwortete ich. »Was sie wollte, hat sie immer bekommen.«
»Manchmal hat sie dir die Hölle heiÃgemacht.«
»Und dir auch«, sagte ich und dachte daran, wie Marie uns zuweilen getriezt hatte. »Deine Mutter machte jedem mal die Hölle heiÃ.«
Als wir heirateten, war Marie Sozialarbeiterin. Sie freundete sich mit ihren Klienten an und litt mit ihnen, und das brachte sie oft an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Von professioneller Distanz hielt sie gar nichts. Wenn davon die Rede war, machte sie sich darüber lustig und sagte verächtlich: »Das heiÃt nur, dass man keine Gefühle zulassen will.« Jahre später kündigte sie aus heiterem Himmel und fing an zu malen und zu zeichnen. Das zog sie zu jedermanns Ãberraschung konsequent durch und brachte es schlieÃlich zu echter Könnerschaft. Ãberall im Haus hängen ihre verschatteten monochromen Bilder von Hauseingängen und menschenleeren StraÃen sowie die grausigen Selbstporträts, die sie kurz vor ihrem Tod angefertigt hatte, als sie nur noch aus Haut und Knochen bestand: Kohlezeichnungen ihres nackten, ausgemergelten Körpers, hingekritzelt wie Giacomettis letzte Porträts. Das war alles, was sie noch zustande brachte. Diese Zeichnungen hatten etwas Wahrh aftiges an sich, insbesondere die Augen. Abgesehen von denen, die wir rahmen lieÃen, bewahre ich in der Schreibtischschublade eine Mappe mit mehreren Dutzend ihrer letzten Bilder auf. Wenn ich sie betrachte, erinnere ich mich jedes Mal an Maries Mut, ihren Willen, bis zum Ende durchzuhalten, nicht, weil sie das Ende verleugnete, sondern weil jeder Moment Erkenntnis verhieÃ. Das hatte mich beeindruckt. Ich glaube kaum, dass ich dazu in der Lage wäre. Marie blieb ihrer Kunst bis zum letzten Atemzug treu. Am Nachmittag, an dem sie starb, fanden sich neben ihrem Bett ein Zeichenblock und mehrere Kohlestückchen.
Marie interessierte sich nur für ihre Sicht der Wahrheit, doch ohne viel Aufhebens darum zu machen. »Es ist ja bloà meine Wahrheit«, sagte sie immer. »Die muss niemand übernehmen.« Wieder etwas, was ihre Spottlust weckte, diese Vorstellung einer allgemein gültigen Wahrheit. Und sie signierte kein einziges ihrer Werke. Ein befreundeter, höchst erfolgreicher Künstler sagte eines Tages zu mir: »Maries Arbeit ist hervorragend, aber sie hat dieses typische Frauenproblem.« Vermutlich meinte er damit, sie sei zu bescheiden. Das war ein
Weitere Kostenlose Bücher