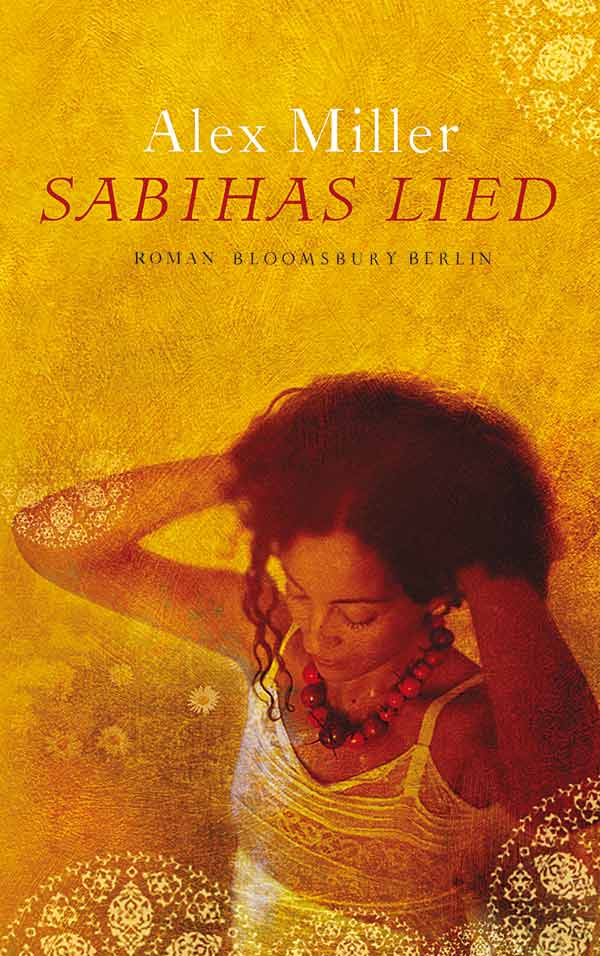![Sabihas Lied]()
Sabihas Lied
Die Welt und seine Altersgenossen hatten ohne ihn weitergemacht. Er hatte keinerlei Kontakte gepflegt. Selbst seiner Schwester Kathy hatte er seit Jahren nicht mehr geschrieben. Abgesehen von den Briefen, die er halbwegs regelmäÃig an seine Eltern schickte, hatte er alle vernachlässigt, die er in Australien kannte. Und seine Eltern lebten ohnehin in der Vergangenheit. Seit sie in diese Altenwohnanlage in Moruya gezogen waren, erzählte seine Mutter von nichts anderem mehr als den herrlichen alten Zeiten, die sie mit ihrem Mann und ihren heranwachsenden Kindern auf der Farm verbracht hatte.
John hängte das Küchentuch an den Nagel und warf einen Blick auf die Uhr. Eigentlich sollte er seinen Weinhändler aufsuchen, um ihm einmal gründlich die Meinung zu sagen. Doch er rührte sich nicht von der Stelle, stützte sich mit einer Hand auf den abgewetzten Tresen und blickte durch die offene Tür hindurch auf das vertraute StraÃenbild. Das hier würde ihm fehlen. Das Chez Dom und die Nachbarn der Rue des Esclaves. Seine Freunde: André, der alte Arnoul, sogar Bruno, und Nejib, der Sabihas Gesang am Samstagabend so gefühlvoll mit seinem Oud begleitete. Vielleicht noch ein oder zwei der anderen Gäste. Es waren natürlich keine engen Freunde. Mit keinem verband ihn die tiefe, tröstliche Freundschaft, die man mit einem Seelenbruder erlebt. Keiner von ihnen las Bücher. Trotzdem würde er sie vermissen. Er würde den Platz vermissen, den er hier gefunden hatte.
John hatte so lange von einer Rückkehr geträumt, dass er sie gar nicht mehr konkret ins Auge fassen konnte. Der gestrige Anruf von Sabihas Vater hatte diese Rückkehr plötzlich in greifbare Nähe gerückt, aber strebte er sie überhaupt noch an? Er blickte weiter auf die StraÃe hinaus, atmete den Duft ein, der aus der Küche zu ihm drang, im Sonnenlicht fielen ihm Arnouls verblasste Stoffballen auf, die Kavi-Brüder in ihrem Lebensmittelladen an der Ecke. Wollte er das alles wirklich aufgeben und in Australien wieder bei null anfangen, einem Land, das er nicht mehr kannte, wo man ihn nicht kannte? Er wusste nicht, was er wollte. Die Fens ter waren schmutzig, so viel stand fest. Er würde sie put zen, anstatt den Weinhändler aufzusuchen. Wenn es darum ging, mit Franzosen zu diskutieren, war er immer im Nachteil. Eine Rückkehr nach Australien hätte den groÃen Vorzug, dass er sich wieder täglich in seiner Muttersprache ausdrücken könnte. Wie weit ging wohl seine Entfremdung von der Heimat? Die Sprache war ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens, der ihm hier fehlte und immer fehlen würde, solange er in Frankreich blieb. Sabihas Englischkenntnisse waren bescheiden, obwohl er versucht hatte, es ihr über die Jahre beizubringen. Wie würde es dann für sie in Australien werden?
Er holte Eimer und Tücher und fing an, die Fenster zu putzen. Vielleicht würden sie dieses Leben hier einfach weiterführen, ohne dramatische Veränderungen, bis sie allmählich André und Simone und dem alten Arnoul Fort glichen. Die Tage so nehmen, wie sie kamen, bis es irgendwann nicht mehr nötig war, über Veränderungen nachzudenken. Bis es keine Zukunft mehr gab, um die man sich sorgen müsste.
A m folgenden Dienstag um fünf nach zwölf kam Bruno Fiorentino durch die Hintertür in die Küche des Chez Dom. Gegen den Bauch presste er eine Kiste halb bis voll ausgefärbter Grosse-Lisse-Tomaten aus seinem Gewächshaus. Noch im Türrahmen stehend, setzte er die Kiste auf dem Boden ab, richtete sich wieder auf, nahm die Mütze ab, wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn und schaute auf seine Tomaten. Er war stolz darauf. Jede einzelne war handverlesen und formvollendet. Dann schaute er zu Sabiha. Sie stand am Herd, mit dem Rücken zu ihm. Da sie sich nicht umdrehte, räusperte er sich und sagte: »Guten Tag, Madame Patterner.« Diese Form der respektvollen Anrede gebrauchte er immer, wenn er mit Johns Frau sprach. »Heute riecht der Eintopf aber besonders gut.«
Dieses Sprüchlein sagte Bruno praktisch jedes Mal auf, wenn er dienstags die Caféküche betrat. Und wenn Sabiha am frühen Freitagmorgen an seinem Marktstand vorbeischaute, um ihn zu grüÃen, war er genauso höflich und machte jedes Mal eine Bemerkung über das Wetter, das unweigerlich schön zu werden versprach, auch bei Regen, da der ja bald
Weitere Kostenlose Bücher