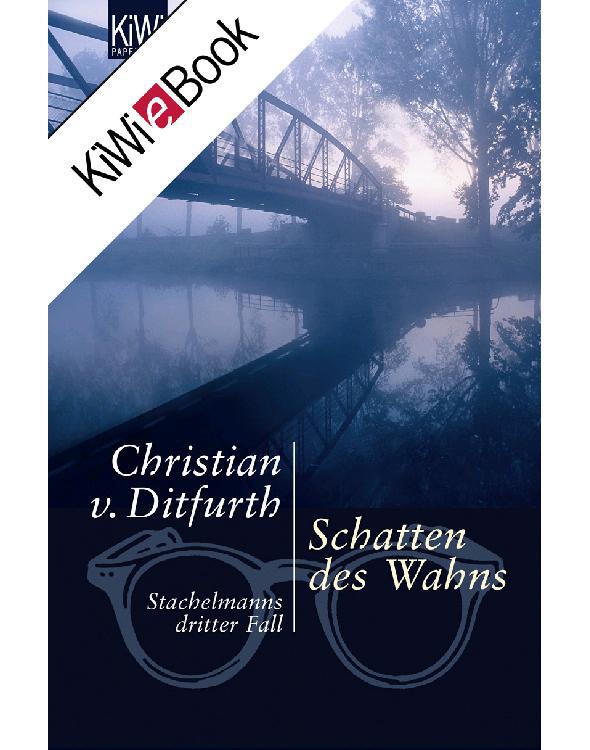![Schatten des Wahns: Stachelmanns dritter Fall (German Edition)]()
Schatten des Wahns: Stachelmanns dritter Fall (German Edition)
Pistole hervorzieht, sie dem L. ans Genick drückt, und dann der Schuss. Der L. fällt nach vorn, halt, aber vorher platzt sein Gesicht weg. Im Traum kotze ich, und wenn ich dann aufwache, ist mir speiübel. Ich habe abgenommen, bin sowieso ein Gestell. Ans Studieren kann ich kaum denken.
Zuletzt traf ich Angelika in der Backmulde, sie bedient dort. Sie hat mich sogar freundlich begrüßt. Ob ich mir das leisten könne, hier zu essen. Ich sähe schlecht aus, ob ich krank sei? Sie machte sich Sorgen, das war schön. Sie sah toll aus. Ob wir nicht mal wieder zusammen was trinken gehen könnten, habe ich gefragt. Ob ich immer noch so verrückt sei, hat sie gefragt. Ich war es noch nie, habe ich gesagt. Und sie hat gesagt, komm, wenn du vernünftig geworden bist. Aber ewig warte ich nicht. Da gibt es einige Bewerber. Und dann hat sie gelacht. Und ich habe gewusst, diese Bewerber taugen nichts.
Heute ist Sonntag, und nichts lenkt mich ab von meiner Angst. Der E. hat gesagt, wir sollten die Gruppe auflösen. Er benutzte das Wort »liquidieren«, aber das hat mich gar nicht erschreckt. Und wohin dann? Die Vereinzelung schreitet voran, die Rechten machen Hackfleisch aus uns. Es gibt noch ein paar Fachschaften. Die Maos machen sich vom Acker, die waren sowieso nur eine Lachnummer. Die Spontis haben sich auch verabschiedet und den AStA-Schlüssel brav im Rektorat abgeliefert. Sie hätten es vielleicht noch einmal herausreißen können mit einer Besetzungsaktion. Aber das hat ja schon beim CA nicht geklappt. Die Bullen müssen uns überall nur noch wegräumen wie Straßenkehrer den Touristenmüll in der Hauptstraße. Die Gesellschaft ist krank, deshalb muss sie zerschlagen werden von denen, die die Gesellschaft für krank erklärt hat. Vielleicht müssen wir in den Untergrund gehen, warten, bis bessere Zeiten anbrechen. Die Revolution ist unvermeidlich. Aber leider wissen wir nicht, wann sie ausbricht. Es ist zum Kotzen. Ich habe solche Angst.
[ Menü ]
13
Am Sonntag, es war der 31. Juli, wartete Stachelmann in Annes Wohnung im Univiertel, dass sie endlich aus dem Urlaub zurückkam. Er lag auf dem Sofa und ließ seine Gedanken wandern. Er hatte am Nachmittag sein Gepäck zu Hause abgestellt und dann seine Mutter besucht im Eppendorfer Krankenhaus. Sie war schwach gewesen, aber doch nicht so niedergeschlagen, wie sie sich zuletzt am Telefon angehört hatte. Sie sagte, eigentlich sei der Befund besser, als sie befürchtet habe. Sie sprach von einem langsam wachsenden Tumor, der weitgehend entfernt worden sei. Sie hatte gelächelt und ihn bald weggeschickt, weil sie müde sei. Sie würde sich freuen, wenn er kommende Woche einmal vorbeischaue, dann sei sie schon kräftiger und könne vielleicht sogar laufen. Was sagte sie, um ihn zu beruhigen? Was war die Wahrheit? Vielleicht wusste sie es selbst nicht mehr. Ihm kam sie vor, als lebte sie in einer anderen Welt.
Er schloss die Augen und mühte sich, seine Recherche in Heidelberg im Kopf zu ordnen. Aber es ging durcheinander. Gleich morgen würde er mit Carmen sprechen. Sie musste ihm helfen.
Endlich klackte das Schloss. Die Tür öffnete sich, Anne schnaufte, dann trat sie in den Flur und stellte zwei Koffer ab. Felix rannte an ihr vorbei durch den Flur, fiel hin, erschrak, stand auf und bremste vor Stachelmann, der sich inzwischen erhoben hatte vom Sofa.
»Papa!«, sagte Felix. Dann noch einmal: »Papa!«
Jetzt erschrak Stachelmann. Er wusste nicht, was er tun sollte.
Anne lachte. »Das hat er schon auf der Fähre gesagt. Offenbar hat er sich in den Kopf gesetzt, du seiest sein Vater. Wenn man sich die Charaktereigenschaften genauer anschaut, könnte es sogar stimmen. Er ist genauso bockig wie du, das steht fest.«
Felix klammerte sich an Stachelmanns Beine.
»Oh«, sagte Stachelmann. »Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich bin gefangen.«
»Pech gehabt«, sagte Anne.
Felix lachte.
Stachelmann bewegte sich vorsichtig auf Anne zu, die stand in der Wohnungstür, noch schnaufend vom Koffertragen. Felix fiel hin, er staunte, dann schrie er los. »Mama!«
Anne ging zu ihm, nahm ihn auf den Arm und tröstete ihn. Sie schaute Stachelmann kurz streng an, dann schüttelte sie den Kopf. Und Stachelmann bekam wieder dieses Gefühl, fehl am Platz zu sein. Anne trug Felix ins Schlafzimmer, er schrie nicht mehr so laut, dann hörte er auf. Nach einer Weile kam Anne zurück aus dem Schlafzimmer, zog die Jacke aus, nahm Stachelmann in den Arm und küsste ihn. »Es ist ja wie
Weitere Kostenlose Bücher