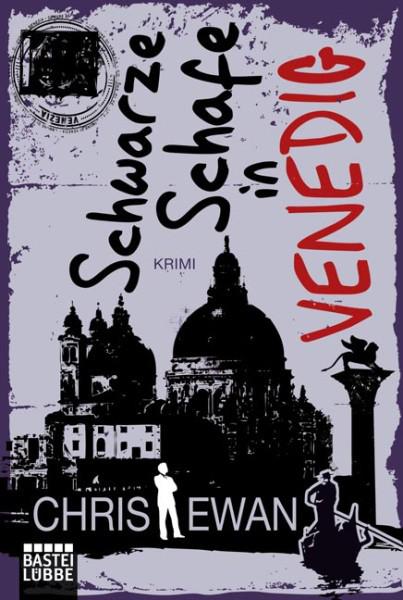![Schwarze Schafe in Venedig]()
Schwarze Schafe in Venedig
Ding war ein Schuh. Braunes Leder, an Kappe und Ferse abgestoßen. Aus dem Schuh ragte ein Knöchel, der in einer beigen Herrensocke steckte. Mehr war nicht zu sehen. Der Rest war hinter einer Auslage verborgen, zumindest, bis auf der anderen Seite die blassen, ausgebreiteten Finger einer Hand auftauchten.
Wie gerne hätte ich mich einfach umgedreht und wäre gegangen. Oder wahlweise auch gerannt. Und als skrupelloser Dieb, der ich doch eigentlich sein sollte, hätte ich das zweifellos tun müssen. Aber wie jeder Mensch habe ich gewisse Charakterschwächen, und dazu gehört, dass ich tatsächlich so ein Gimpel war, hinzugehen und mir die Sache genauer anzusehen.
Zuerst begutachtete ich den Fuß. Eine gute Wahl. Der harte Terrazzoboden war trocken. Was man von dem Bereich rund um den Kopf nicht gerade behaupten konnte. Blut. Jede Menge Blut. Gesicht und Hände lagen in einer Lache, es sammelte sich zwischen den ausgebreiteten Fingern seiner ausgestreckten Hand zu einer Pfütze und lief ihm unter die Fingernägel. Es sah aus, als habe jemand einen Farbeimer über ihm ausgekippt. Womöglich auch zwei. Das Blut glitzerte im Schein meiner Taschenlampe und schimmerte wie Preiselbeersaft.
Das Gesicht lag auf der Seite, der Mund stand leicht offen, und seine Lippen berührten die Lache, als wollte er Blut und Leben wieder in sich aufsaugen. Der rechte Arm ruhte angewinkelt unter der Brust, und der Ellbogen stand in einem seltsamen Winkel hervor, sodass seine Hand nicht zu sehen war.
Ich drehte mich zum Schaufenster hinter mir um. Keine Zuschauer.
Vorsichtig stieg ich über die Lumpenpuppenbeine, wobei mir das Wasser aus den Schuhsohlen und den Hosenbeinen tropfte, dann hockte ich mich neben den Torso und schaute genauer hin. Seine Augen waren aufgequollen und traten hervor, als sei er genauso erschrocken, mich zu sehen, wie ich bei seinem Anblick. Er sah tot aus – ganz ohne Frage –, aber da ich mich in der Vergangenheit diesbezüglich auch schon geirrt hatte, wollte ich den gleichen Fehler nicht noch mal machen. Ich musste den Kopf zur Seite drehen, aber es grauste mir bei der Vorstellung, ihn anzufassen, selbst mit Gummihandschuhen. Auf einer Ablage über mir stand ein Becher voller Bleistifte. Einen davon zog ich heraus, steckte ihm das Ende mit dem Radiergummi in der Mund und verkeilte es dann innen in seiner Wange. Dann zog ich. Das Gesicht drehte sich und drehte sich und dann ...
Scheiße.
Ich ließ den Bleistift fallen und plumpste unsanft auf meine Kehrseite. Kroch rückwärts krabbelnd und rutschend über den Boden, bis ich mit voller Wucht in ein Regal mit Schreibblöcken krachte. Dort blieb ich einen Moment sitzen und fluchte kaum hörbar, als murmele ich einen magischen Bannspruch, der das schreckliche Bild auslöschen sollte, das drohte, sich in mein Hirn zu brennen.
Es war also nicht bloß Pfeifenrauch gewesen, den ich beim Hereinkommen gerochen hatte. Daruntergemischt war auch der Geruch einer rauchenden Pistole gewesen – der heiße, dunstige Qualm einer aus nächster Nähe abgefeuerten Kugel. Dem Kerl fehlte die Hälfte des Gesichts, und das bisschen, was noch übrig war, war kaum der Rede wert. Es sah fast aus, als hätte er selbst die Waffe gegen sich gerichtet. Es gab keinerlei Anzeichen, die auf einen Kampf oder Einbruch hindeuteten, und als ich ankam, war der Laden abgeschlossen gewesen. Ich hatte zwar keinen Schimmer, was ihn dazu getrieben haben könnte, aber er musste sich die Waffe in den Mund gesteckt und dann abgedrückt haben. Es war äußerst unschön, alles nur noch eine zerfetzte Masse.
Mit zitternden Händen tastete ich nach meiner Taschenlampe und richtete sie auf die Regale neben mir. Blutspritzer – an der Wand, der Decke, der Auslage mit dem teuren Geschenkpapier, das an einem Ständer mit herausziehbaren Armen hing. So marmoriert, wie das Papier jetzt war, hätte es Graziellas Onkel sicher nicht gefallen, wobei keine Gefahr mehr bestand, dass er sich die Bescherung ansehen musste. Und seine Pfeife würde er sicher auch nicht mehr rauchen – zumindest nicht in diesem Leben. Er war so tot, wie man nur sein konnte.
Ich schaute mich kurz um, ob irgendwo eine Waffe zu sehen war, aber vergeblich. Was zwar ziemlich seltsam war, mich aber auch nicht mehr beunruhigte als der Anblick dessen, was er sich damit angetan hatte. Und warum zerbrach ich mir überhaupt den Kopf? Sollte ich sie finden, würde ich die Waffe ganz sicher nicht mal mit einer Kneifzange anfassen. Gut möglich,
Weitere Kostenlose Bücher