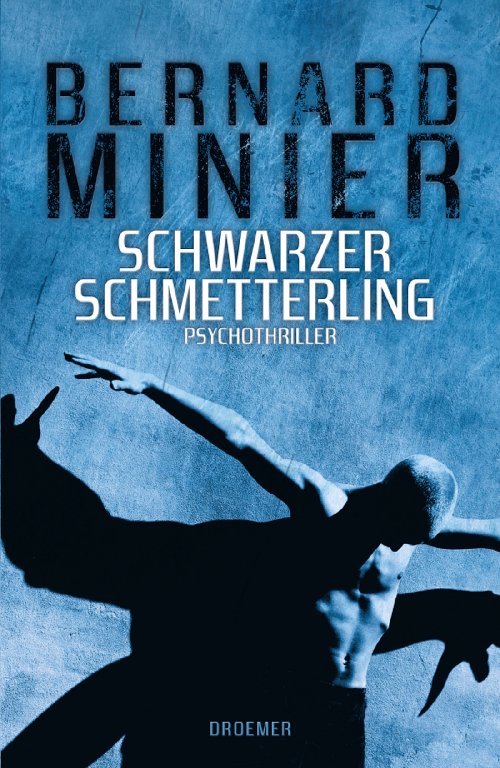![Schwarzer Schmetterling]()
Schwarzer Schmetterling
Regencapes
erwähnt, das Rascheln des wasserundurchlässigen schwarzen Stoffs, wenn sich die Täter regten oder bewegten. »Dieses Geräusch«, schrieb sie, »werde ich nie vergessen. Es wird für mich immer bedeuten, dass das Böse existiert und dass es laut ist.«
Dieser letzte Satz hatte Servaz in einen Abgrund der Nachdenklichkeit gestürzt. Als er weiterlas, wurde ihm klar, warum er in Alices Zimmer kein Tagebuch gefunden hatte, kein einziges Schriftstück von ihrer Hand:
Ich habe Tagebuch geführt. Ich habe darin mein kleines Leben
DAVOR
geschildert, Tag für Tag. Ich habe es zerrissen und weggeworfen. Was für einen Sinn hätte es gehabt,
DANACH
noch ein Tagebuch zu führen? Diese Mistkerle haben nicht nur meine Zukunft versaut, sie haben auch meine Vergangenheit für immer verpfuscht.
Ihm wurde klar, dass sich Alice nicht dazu hatte durchringen können, ihre Notizbücher wegzuwerfen: Es war vielleicht der einzige Ort, an dem die Wahrheit über die Geschehnisse aufbewahrt wurde. Aber gleichzeitig wollte sie sicher sein, dass ihre Eltern sie nicht fanden.
Daher das Versteck …
Vermutlich wusste sie, dass ihre Eltern nach ihrem Tod ihr Zimmer nicht anrühren würden. Zumindest hoffte sie es wohl. So wie sie wohl insgeheim hoffte, dass jemand eines Tages die Notizbücher finden würde … Vermutlich hatte sie nicht gedacht, dass es so viele Jahre dauern würde und dass der Mann, der sie schließlich aufspürte, ein völlig Fremder sein würde. Jedenfalls hatte sie sich nicht dafür entschieden, »die Dreckskerle zu kastrieren«, sie hatte nicht die Rache gewählt.
Aber ein anderer hatte es für sie getan …
WER
?
Ihr Vater, der auch um ihre Mutter trauerte? Ein anderer Verwandter? Oder ein missbrauchtes Kind, das sich nicht umgebracht hatte, sondern zu einem wutschnaubenden Erwachsenen geworden war, für immer von einem unstillbaren Rachedurst erfüllt?
Als Servaz mit seiner Lektüre fertig war, hatte er die Notizbücher weit von sich weggestoßen und war auf den Balkon getreten. Er hatte das Gefühl zu ersticken. Dieses Zimmer, diese Stadt, diese Berge. Er wünschte sich weit weg.
Als er das Frühstück hinuntergeschlungen hatte, ging er wieder hinauf in sein Zimmer. Im Bad ließ er Wasser in das Zahnputzglas laufen und nahm zwei der Tabletten, die ihm Xavier gegeben hatte. Er fühlte sich fiebrig, und ihm war schlecht. Winzige Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Der Kaffee, den er gerade getrunken hatte, schien in seinem Magen zu stehen. Er duschte lange unter dem heißen Wasserstrahl, zog sich an, steckte sein Handy ein und verließ das Zimmer.
Der Cherokee stand etwas weiter unten, vor einem Likör- und Souvenirladen. Es fiel ein starker, kalter Regen, der den Schnee durchlöcherte, und das Gurgeln des abfließenden Wassers in den Gullys erfüllte die Straßen. Am Lenkrad des Jeeps sitzend, rief er Ziegler an.
Kaum war Espérandieu an diesem Morgen an seinem Schreibtisch, griff er zum Telefon. Sein Anruf hallte in einem halbkreisförmigen, zehnstöckigen Gebäude wider, das sich in der Rue du Château-des-Rentiers (ein durchaus passender Name) Nummer 122 im 13 . Pariser Arrondissement befand. Eine Stimme mit einem leichten Akzent antwortete ihm.
»Wie geht’s, Marissa?«, fragte er.
Commandant Marissa Perl arbeitete im Dezernat für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, Unterabteilung Wirtschafts- und Finanzdelikte. Ihr Spezialgebiet war internationale Wirtschaftskriminalität. Marissa war unschlagbar, was ihr Wissen über Finanz- und Steuerparadiese betraf, über Geldwäsche, aktive und passive Korruption, manipulierte Auftragsvergabe, Unterschlagung, Vorteilsannahme, multinationale Unternehmen und organisiertes Verbrechen. Außerdem war sie eine ausgezeichnete Pädagogin, und Espérandieu war begeistert gewesen von dem Kurs, den sie an der Polizeiakademie abgehalten hatte. Er hatte viele Fragen gestellt. Nach dem Kurs hatten sie zusammen ein Gläschen getrunken und dabei weitere gemeinsame Interessen entdeckt: Japan, Independent-Comics, Indie-Rock … Espérandieu hatte Marissa in die Liste seiner Kontaktpersonen aufgenommen und sie genauso: In ihrem Beruf ließen sich mit einem guten Netz von Kontakten oftmals festgefahrene Ermittlungen wieder in Gang bringen. Hin und wieder brachten sie sich mit einer E-Mail oder einem Telefonat gegenseitig in Erinnerung, vielleicht in Erwartung des Tages, an dem einer der beiden die Dienste des anderen bräuchte.
»Ich hab
Weitere Kostenlose Bücher