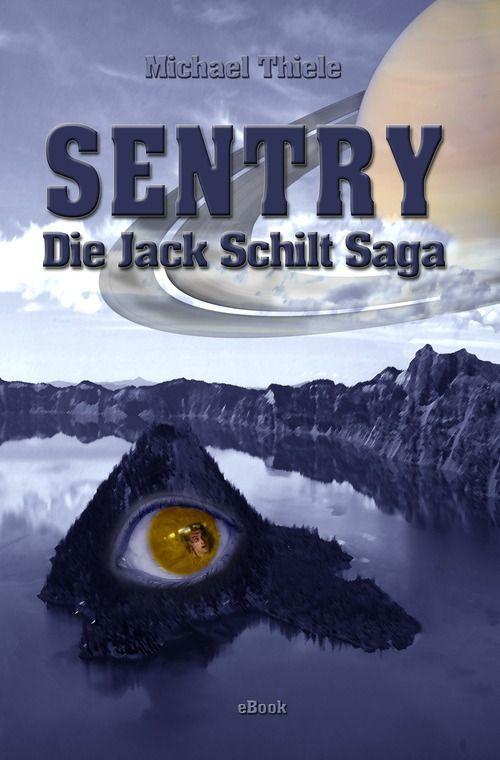![Sentry - Die Jack Schilt Saga: Die Abenteuer des Jack Schilt (German Edition)]()
Sentry - Die Jack Schilt Saga: Die Abenteuer des Jack Schilt (German Edition)
sanften, langen Beinen. Zu sacht für einen massigen Opreju. Ich hob behutsam den Kopf an, um meinen Augen bessere Sicht zu gewähren. Nur wenige Meter entfernt schritt er langsam wie in Zeitlupe durch das feinmaschige Gitter des Schilfs, ein großer grauer Schreitvogel, dessen Art ich nicht mit Namen kannte. Luke hätte es bestimmt gewusst. Nur einmal blickte er prüfend in meine Richtung, widmete sich aber dann wieder restlos seinen eigenen Geschäften. Auf spindeldürren, runzligen Beinen stak er bedächtig voran, mal schneller, mal langsamer, mal verharrend auf der Suche nach Beute, bis er aus meinem Blickfeld verschwand.
Das Erscheinen und Verschwinden des Tieres machte Mut. Die Anwesenheit eines wachsamen Wasservogels bestärkte mich in dem Glauben, nicht unmittelbarer Gefahr ausgesetzt zu sein. Dennoch meldete sich tief in mir ein Sinn, ein Stimmchen, hauchzart, welches mir verbat, mich auf den Weg ans Ufer zu machen.
Gerade als ich beschloss, diese Stimme zu ignorieren und das Wasser endlich zu verlassen, vernahm ich einen schrillen Ruf, den Warnschrei eines Vogels. Flatternde Flügel schlugen gegen Schilfrohr, als sich ein großer grauer Schreitvogel zu meiner Rechten in die Lüfte erhob, heftig protestierend über mich hinwegflog und der Uferlinie folgend in östlicher Richtung verschwand.
Was hatte das Tier dazu veranlasst, das schützende Dickicht zu verlassen? Die Gründe konnten mannigfaltig sein. Dennoch beunruhigte mich die plötzliche Flucht des Vogels, und ich wünschte inständig, ich hätte auch Flügel, um ihm zu folgen. Weiterhin bewegungslos verharrend lauschte ich angestrengt. Leises rhythmisches Plätschern fand den Weg in meinen Gehörgang, das ich in dieser Art während der Zeit, in der ich wie paralysiert dalag, noch nicht vernommen hatte. Zunächst schien es weit entfernt, nahm aber unverkennbar an Intensität zu. Es näherte sich vom Ufer und wurde stetig lauter. Irgendetwas watete durch das seichte Ufergewässer – diesmal war es kein vorsichtiges Staken, ganz im Gegenteil – und offenbar nicht ziellos.
Mein Herz begann erneut zu hämmern. Behutsam hob ich den Kopf an und spähte in die Richtung, aus der das alarmierende Geräusch kam. Doch da war nichts zu sehen. Geräuschlos löste ich mich aus der Umklammerung der Schlingpflanzen und ließ meinen Körper absinken, bis nur noch der Kopf aus dem Wasser ragte. Grünes Pflanzenwerk um mein Haupt drapierend wurde ich eins mit der Umgebung und hoffentlich so gut wie unsichtbar.
So getarnt wartete ich auf das, was geschehen würde. Und ich musste nicht lange warten. Meine Nervosität steigerte sich ins Unerträgliche und es bedurfte einer gehörigen Portion Standhaftigkeit, nicht den sofortigen Rückzug hinaus auf den See anzutreten. Doch diese Option, so wusste ich, blieb mir nicht.
Heftige Bewegungen im Schilf kündigten Unheil an. Es rauschte mächtig, als sich ein Opreju seinen Weg durch das Dickicht bahnte. Ich zwang mich dazu, die Augen geöffnet zu lassen, flehend, dass meine Tarnung ausreichte. Aus der Froschperspektive wirkte dieses unheimliche Wesen noch weitaus furchterregender. Zwar befand sich der Opreju noch einige Körperlängen entfernt, doch wirkte er so, als könnte er mich mit seinen ausgestreckten Knochenarmen bereits erreichen. Das Wasser ging ihm bis zur Brust, doch der Teil seines Körpers, der herausreichte, ragte schätzungsweise anderthalb Meter empor. In der Tat verfügte dieses Monster über eine Körperlänge von geringstenfalls drei Metern.
Welch Koloss!
Standhaft starrte ich in seine milchig-grünen Augen, welche auf den ersten Blick stockblind wirkten, sich jedoch zu sehr suchend hin und her bewegten, um zu keiner Wahrnehmung fähig zu sein. Der bleiche, knöcherne Schädel, aus dem lange schwarze Büschel garstiger Haare sprossen, regte sich dabei so gut wie nicht. Dann begann der Opreju zu schnüffeln: er sog geräuschvoll Luft durch das, was ich als sein Riechorgan identifizierte – ein simples schwarzes Loch in der Mitte jenes unbeschreiblichen Antlitzes – und stieß sie noch vernehmbarer wieder heraus. Ein furchtbarer Verdacht beschlich mich: Was, wenn sich dieses Wesen durchs Leben witterte, sein Hauptsinn nicht die Augen sondern die Nase darstellte? Was nützte mir die beste Tarnung, wenn er mich schlicht und einfach riechen konnte?
Der Fluchtimpuls ließ sich nur noch mit größter Mühe unterdrücken. Ich wollte dem Opreju keinen weiteren Zentimeter mehr zugestehen. Sollte er noch einen
Weitere Kostenlose Bücher