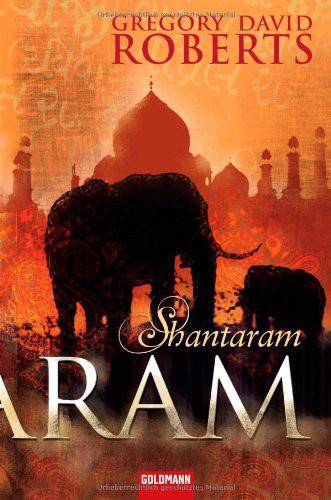![Shantaram]()
Shantaram
Zerstreuung, Klänge und Farben. Man musste nur wissen, wo sie zu finden waren. Das Restaurant beim Haji-Ali-Schrein war einer dieser Orte. Jede Nacht kamen Hunderte von Menschen dorthin, um andere zu treffen, zu essen und Getränke, Zigaretten oder Süßigkeiten zu kaufen. In einem nicht abreißenden Strom trafen sie ein, in Taxis, Privatwagen oder auf Motorrädern, bis zum Tagesanbruch. Das Restaurant selbst war klein und immer voll, weshalb die meisten Gäste es vorzogen, auf dem Gehweg zu stehen und sich zum Essen in oder auf ihre Autos zu setzen. Aus vielen Wagen dröhnte Musik, und man hörte Rufe auf Urdu, Hindi, Marathi und Englisch. Kellner eilten von der Theke zu den Autos und wieder zurück und transportierten mit versierter Eleganz Getränke, Päckchen und Tabletts.
Das Restaurant ignorierte die Sperrstunde und hätte eigentlich von den Beamten des Polizeireviers zwanzig Meter weiter geschlossen werden müssen. Aber der indische Pragmatismus erkannte an, dass auch der zivilisierte Großstadtbürger Plätze braucht, auf denen er jagen und sammeln kann. Und so wurde großzügig darüber hinweggesehen, dass die Besitzer dieser Oasen des Lärms und Vergnügens Beamte und Polizisten bestachen, damit ihre Lokale die ganze Nacht geöffnet bleiben konnten – was allerdings nicht gleichbedeutend mit einer Konzession war: Bars und Restaurants wie das Haji-Ali wurden illegal betrieben, und gelegentlich musste der Anschein von Gesetzestreue erweckt werden. Die Beamten auf der Wache wurden regelmäßig telefonisch gewarnt, wenn ein Polizeichef, Minister oder sonstiger VIP an dem Restaurant vorbeizufahren gedachte. Dann taten sich alle zusammen, man löschte das Licht, die Autos zerstreuten sich, und das Restaurant schloss vorübergehend. Diese mit der Illegalität einhergehende Unannehmlichkeit schreckte die Leute jedoch nicht ab; vielmehr verlieh sie dem banalen Akt, einen Imbiss zu sich zu nehmen, einen Hauch von Glamour und Abenteuer. Und jeder wusste, dass das Haji-Ali-Restaurant – genau wie alle anderen illegalen Nachtlokale, die eine Schließung vortäuschen mussten – in weniger als einer halben Stunde wieder geöffnet sein würde. Jeder wusste von den Bestechungsgeldern, die gezahlt und kassiert wurden. Jeder wusste von den telefonischen Warnungen. Alle profitierten in irgendeiner Weise, und alle waren mit der Situation zufrieden. Das Schlimmste an der Korruption als Regierungsform, hatte Didier einmal gesagt, ist, dass sie so gut funktioniert.
Der Oberkellner, ein junger Marathe, kam zu unserem Wagen geeilt und nahm mit energischem Kopfnicken unsere Bestellungen entgegen, die der Fahrer für uns aufgab. Abdullah stieg aus und ging zu der langen Imbisstheke, an der sich die Leute drängten. Ich beobachtete ihn. Er bewegte sich mit der Eleganz eines Athleten. Abdullah war größer als die meisten anderen jungen Männer, und seine Körperhaltung vermittelte ein beeindruckendes Selbstbewusstsein. Sein schwarzes Haar trug er schulterlang. Er war schlicht und preiswert gekleidet – weiche schwarze Schuhe, schwarze Hose, weißes Seidenhemd –, doch die Sachen standen ihm gut. Muskulös wie er war, verliehen sie ihm eine gewisse martialische Eleganz. Ich schätzte ihn auf etwa achtundzwanzig. Als er sich zum Auto umdrehte, erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht. Es war ein schönes Gesicht, ruhig und gelassen. Ich kannte den Ursprung dieser Gelassenheit. Ich hatte erlebt, mit welch tödlicher Schnelligkeit er den Schwertkämpfer in der Haschischhöhle entwaffnet hatte. Einige Kunden und alle Angestellten hinter der Theke kannten Abdullah, und während er Zigaretten und Betel bestellte, redeten, lächelten und scherzten sie miteinander. Doch ihre Gesten wirkten plötzlich übertrieben, und sie lachten lauter als zuvor und berührten ihn häufig beim Sprechen. Es hatte den Anschein, als wollten sie um jeden Preis von ihm gemocht oder wenigstens beachtet werden. Doch zugleich spürte ich auch ein gewisses Zögern in ihrem Verhalten – eine Art Widerstreben –, als ob sie ihn ungeachtet dessen, was sie ihm durch Worte und Lächeln zu vermitteln suchten, nicht wirklich schätzten, ihm nicht trauten. Es war unübersehbar, dass sie ihn fürchteten.
Der Kellner näherte sich mit unserem Essen und unseren Getränken, die er dem Fahrer reichte. Vor Khaderbhais offenem Fenster zögerte er einen Moment und bat ihn mit den Augen um die Erlaubnis zu sprechen.
»Dein Vater, Ramesh, geht es ihm gut?«, fragte
Weitere Kostenlose Bücher