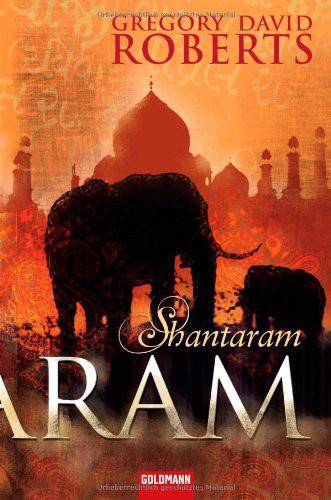![Shantaram]()
Shantaram
»Didier Levy lässt nie jemanden hängen! Es sei denn, es ist unziemlich früh am Morgen. Du weißt doch, Lin, dass ich Morgenmenschen beinahe ebenso sehr hasse wie Polizisten. Alors, gehen wir!«
In Didiers Wohnung rasierte ich mich, duschte und zog die neuen Sachen wieder an. Didier bestand darauf, mir etwas zu essen zu machen, und bereitete ein Omelett zu, während ich in den Kisten mit meinen Sachen nach meinem Geld – neuntausend US-Dollar –, den Motorradschlüsseln und meinem besten falschen Ausweis suchte. Es war ein kanadischer Reisepass mit Foto und genauen Angaben zur Person, aber das Visum war abgelaufen. Ich musste es so schnell wie möglich erneuern. Wenn mit meinem Plan etwas schieflief, brauchte ich viel Geld und einen lupenreinen Pass.
»Und was hast du nun vor?«, fragte Didier, als ich den letzten Bissen nahm und aufstand, um das Geschirr in die Spüle zu stellen.
»Zuerst muss ich meinen Pass auf Vordermann bringen«, antwortete ich, noch kauend. »Und dann werde ich Madame Zhou aufsuchen.«
»Was?«
»Ich werde mir Madame Zhou vorknöpfen. Für klare Verhältnisse sorgen. Khaled hat mir …« Ich brach ab, weil plötzlich Khaled Ansari vor meinem geistigen Auge auftauchte. Khaled, wie ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Als er im Schnee und in der Dunkelheit verschwand. Ich zwang mich, das Bild aus meinem Kopf zu verdrängen. »Khaled hat mir in Pakistan deinen Brief gegeben. Danke übrigens dafür. Aber ich kapiere die ganze Geschichte noch immer nicht. Ich begreife nicht, weshalb sie mich so gehasst hat, dass sie mich ins Gefängnis stecken ließ. Ich hatte keinerlei persönliche Probleme mit ihr. Jetzt allerdings schon. Vier Monate Arthur Road sind ein gewaltiges Problem. Deshalb brauche ich mein Motorrad. Ich will nicht mit Taxis fahren. Und deshalb muss mein Pass astrein sein. Wenn die Cops sich einschalten, muss ich einen überzeugenden Ausweis haben.«
»Ja, aber weißt du denn nicht Bescheid? Es gab letzte Woche – nein, vor zehn Tagen – einen Anschlag auf Madame Zhou. Der Mob, einige von den Sena-Leuten, haben den Palace zerstört. Erst sind sie reingestürmt und haben alles kaputt geschlagen. Dann haben sie Feuer gelegt. Das Haus steht noch. Die Treppen und die oberen Räume sind noch da. Aber der Palace ist Geschichte. Sie werden ihn wohl bald abreißen. Er ist erledigt, Lin. Und sie auch, La Madame.«
»Ist sie tot?«, knurrte ich.
»Nein. Sie ist am Leben. Und es heißt, sie sei auch noch dort. Aber ihre Macht ist zerstört. Sie hat nichts mehr. Und sie ist nichts mehr. Nur noch eine Bettlerin. Ihre Diener suchen die Straßen nach Essensresten für sie ab, während sie darauf wartet, dass das Haus einstürzt. Es ist aus und vorbei mir ihr, Lin.«
»Nein. Noch nicht ganz.«
Ich ging zur Wohnungstür, und Didier lief mir nach. Das war die schnellste Bewegung, die ich je bei ihm gesehen hatte, und ich musste unwillkürlich grinsen.
»Lin, bitte, überleg dir das noch einmal. Wir können hier in Ruhe ein, zwei Flaschen Wein zusammen trinken, non ? Das wird dich beruhigen.«
»Ich bin jetzt schon ganz ruhig«, erwiderte ich, über seine Fürsorge lächelnd. »Ich weiß noch nicht … was ich tun will. Aber ich muss diese Sache für mich abschließen, Didier. Ich kann … einfach noch nicht loslassen. Ich wünschte, ich könnte es. Aber … es hängt einfach zu viel damit zusammen … glaube ich.«
Ich konnte es ihm nicht erklären. Dass es um mehr als Rache ging, war mir bewusst, aber das Gespinst der Verbindungen zwischen Zhou, Khaderbhai, Karla und mir war so von Scham, Geheimnissen und Betrug durchsetzt, dass es mir nicht gelang, mich selbst damit auseinanderzusetzen oder mit meinem Freund darüber zu sprechen.
»Bien«, seufzte Didier ergeben. »Wenn du sie unbedingt aufsuchen willst, dann komme ich eben mit.«
»Auf keinen Fall –«, widersprach ich, aber er brachte mich mit einer erbosten Handbewegung zum Schweigen.
»Lin! Ich bin derjenige, der dir von … von dieser furchtbaren Sache erzählt hat, die sie dir angetan hat. Nun muss ich dich auch begleiten, sonst bin ich verantwortlich für alles, was passiert. Und du weißt doch, mein Freund, dass ich Verantwortung beinahe ebenso sehr hasse wie die Polizei.«
A CHTUNDDREISSIGSTES K APITEL
D idier Levy war der schlimmste Sozius, mit dem ich je Motorrad gefahren war. Er klammerte sich so krampfhaft an mir fest, dass ich kaum lenken konnte. Wenn wir uns einem Auto näherten, heulte er auf, und wenn ich
Weitere Kostenlose Bücher