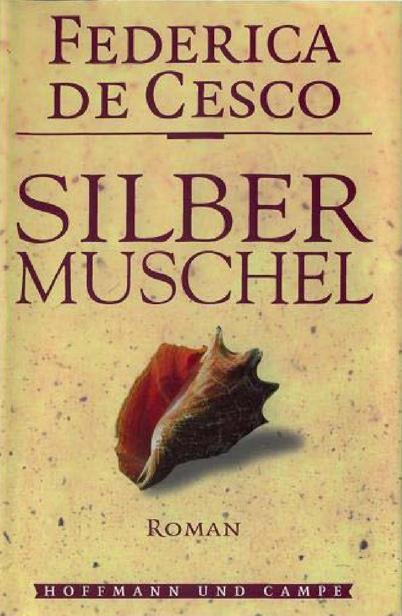![Silbermuschel]()
Silbermuschel
diesem Gewühl«, meinte er und sah mich an. »Aber ich habe mein Möglichstes getan.«
»Ach, guten Morgen!« rief ihm Charles, überquellend vor Herzlichkeit, zu.
»Was trinkst du?«
»Ich glaube, ich nehme auch ein Bier. Wie ich sehe, seid ihr schon fleißig bei der Arbeit.«
Michael bot mir eine Zigarette an, die ich ablehnte.
»Ich habe Sie gestern abend mehrmals angerufen. Waren Sie nicht in Ihrem Zimmer?«
»Doch. Aber ich schlief.«
Charles fragte, ob er zum Mittagessen bleiben wolle. Michael schüttelte den Kopf. Er habe nur kurz vorbeikommen wollen. Franca sah plötzlich auf die Uhr und sagte, sie wolle noch einen Rundgang machen.
»Kommst du auch?« fragte sie Charles. Zu mir sagte sie: »Trink in Ruhe deinen Orangensaft aus und leiste Michael etwas Gesellschaft. Wir treffen uns anschließend am Schweizer Stand.«
79
Es war offensichtlich, daß sie mich mit Michael allein lassen wollte. In mir stieg jene unvernünftige, namenlose Angst eines Kindes auf, das man in der Dunkelheit allein läßt. Michael fuhr fort, mich anzustarren. Nach einer Weile brach er das Schweigen.
»Ich bin gekommen, weil ich Sie sehen wollte. Ich habe den Eindruck, daß Sie Angst vor mir haben. Ich bin ganz harmlos, wissen Sie.«
Meine Lippen bewegten sich. Ich stammelte: »Sie benutzen ein Parfüm, das ich kenne.«
»Habanita, von Molinard«, sagte er. »Eigentlich ist es ein Frauenduft, aber ich gebrauche es schon seit Jahren. Mögen Sie es?«
Vor meinen Augen formte sich ein Bild: die Flasche, zwischen blauen und weißen Kacheln, daneben der Rasierpinsel, die Klingen, das zertrocknete Seifenstück. Ich stehe vor dem Waschbecken, krümme mich vor Leibschmerzen und wasche meine Stoffbinde aus. Die Binde ist voller Blut.
Was du auch denkst, laß dir nichts anmerken.
Die Kälte griff auf meine Beine über. Ich suchte eine Stütze, lehnte mich an die Bar. Michael fingerte an seiner Zigarette.
»Ich würde Ihnen gern Tokio zeigen. Sie haben ja kaum Zeit, etwas davon zu sehen. Tokio auf eigene Faust zu entdecken ist fast unmöglich. Die Straßen haben weder Namen noch Hausnummern. Keiner kennt sich aus, nicht einmal die Taxifahrer.«
»Ich habe keine Angst«, sagte ich.
»Für mich ist Tokio ein Alptraum. Ein städtebauliches Ungeheuer, häßlich, kitschig und nicht einmal exotisch. Das Individuum hat in dieser Stadt alles, nur keine Priorität.«
»Mir gefällt es hier«, sagte ich.
»Vielleicht haben Sie tatsächlich die Herzenseinfalt, überall nur Positives zu sehen.« Seine Stimme klang grimmig und sarkastisch. »Ich persönlich bin unfähig, kritiklos durchs Leben zu gehen. Hier ist alles nur Schein und Trug, jede Dienstleistung Halsabschneiderei, jedes Lächeln fauler Zauber. Die Japaner haben Angst vor uns, wissen Sie das? Ihre Höflichkeit uns gegenüber drückt nicht nur Servilität, sondern ein tatsächlich empfundenes Unterlegenheitsgefühl aus. Und da ihnen dieses Gefühl durchaus bewußt ist, hassen sie uns.«
Ich holte tief Luft. Sei ganz ruhig, und es wird dir nichts passieren. Du bist die Stärkere.
»Meinen Sie nicht auch«, sagte ich, »daß jeder eine Situation aus eigener Sicht beurteilt? Vielleicht ist alles ganz anders, und Sie haben nur das Geheimnis nicht begriffen.«
Er lachte halblaut.
»Wissen Sie, warum ich Sie mag? Sie sind geradezu erquickend ahnungslos.
Erlauben Sie jedoch, daß ich Sie aufkläre: Kein Japaner zeigt sich, wie er ist, vor 80
allem nicht einem Fremden gegenüber. Hier gilt nur die Hierarchie, das Gesetz der Allgemeinheit. Der Gaijin paßt da nicht hinein, deshalb meidet der Japaner den Kontakt mit ihm.«
Ich zitterte zunehmend stärker. Das Negative seiner Persönlichkeit legte sich wie dunkler Frost auf meine Haut. Tief in meinem Zwerchfell pochte etwas mit schwacher, aber ununterbrochener Kraft. Es war bereit zu kommen. Es hing nur von mir ab. Nimm dich zusammen. Warte.
»Warum sagen Sie nichts?« fragte Michael. »Haben Sie den Eindruck, daß ich Ihnen etwas vorlüge?«
»Keineswegs«, sagte ich, halb abwesend. »Was Sie sagen, entspricht durchaus Ihren Empfindungen.«
»Ich stelle fest«, sagte er langsam, »daß es nicht einfach ist, Ihren Gedanken zu folgen. Alles, was Sie sagen, kann mißverstanden werden.«
»Das liegt nicht an mir.«
Er lachte, schon wieder amüsiert. Er wirkte auf mich wie eine Collage aus alten Bildern, die alle mit einer Erinnerung zusammenhingen. Er trat noch dichter an mich heran. Ich rückte behutsam von ihm ab. Er merkte es
Weitere Kostenlose Bücher