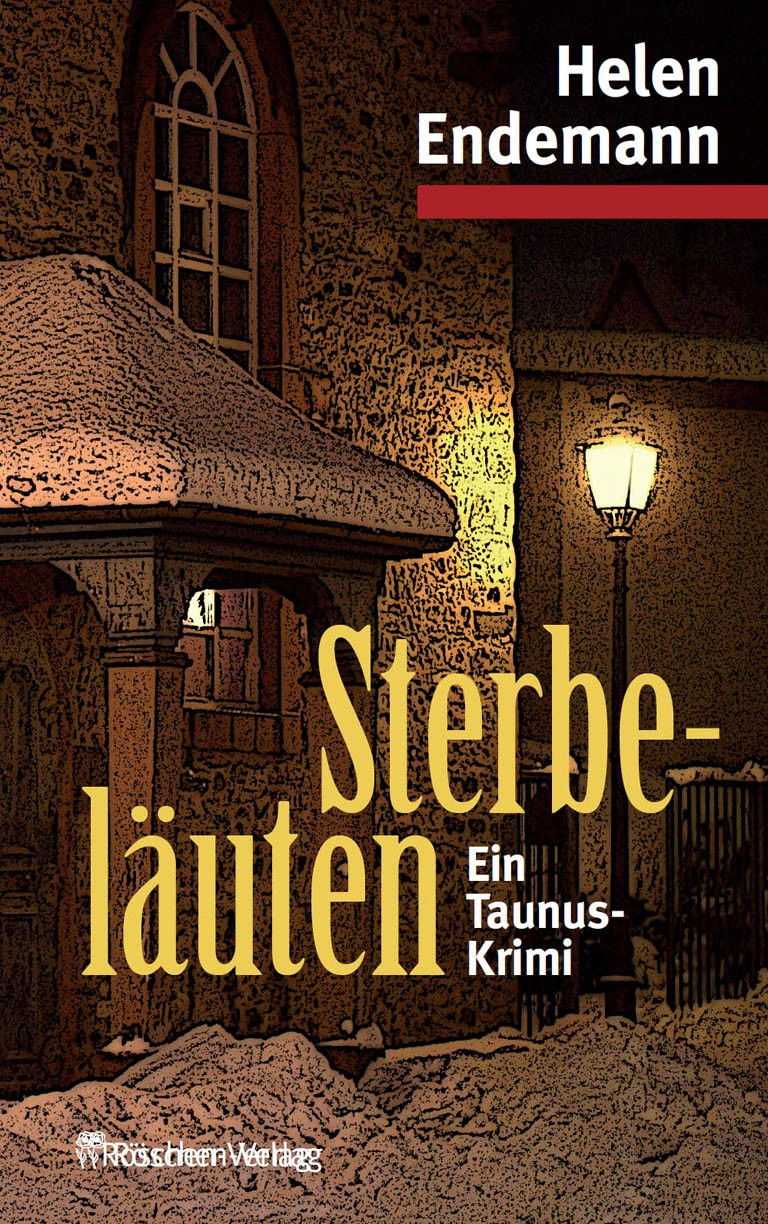![Sterbelaeuten]()
Sterbelaeuten
Gottesdienst. Und wo ein Gottesdienst war, war auch der Organist nicht weit. Der Wind heulte leise durch den Metallrahmen des Fensters. Auf dem Flur waren schlurfende Schritte zu hören. Eine Tür schlug irgendwo zu.
Niemand würde es merken, wenn er diesen Fall einfach ruhen ließe. Die Nichte würde vielleicht noch mal anrufen, vielleicht auch nicht. Möglich, dass sie sich über ihn beschwerte, wenn er wegen des Schmucks nichts unternahm. Seine Vorgesetzten würden selbstverständlich davon ausgehen, dass er aufgrund des großen Arbeitsanfalls diesem Fall keine hohe Priorität beimessen konnte. Es sprach ja doch viel für eine natürliche Todesursache. Und wer weiß, vielleicht hatte die alte Dame den Schmuck verschenkt.
Mertens steckte den Kopf in Röhrigs Büro.
„Kommst du heute Abend?“
„Ja. Aber später. Wenn die Rede vorbei ist.“
Am Abend war Weihnachtsfeier der Dienststelle. Röhrig konnte schon den Gedanken an die mit Erfolgsstatistik gewürzten, den chronischen Personalmangel beschönigenden Plattitüden des Dienststellenleiters kaum ertragen. Er hörte sich das nicht mehr an, wenn er nicht musste. Aber gar nicht hinzugehen, würde bei den Kollegen sehr desinteressiert wirken. Im Leben musste man viele Kompromisse machen.
Mertens nickte und machte diese blöde Mit-dem-Zeigefinger-auf-ihn-zeige-Geste, die sagen sollte, „du bist mein Mann“, oder was auch immer. Dann trollte er sich.
Vielleicht war der Fall Fromme ein Zeichen, und Röhrig sollte in dieser vorweihnachtlichen Zeit einen Adventsgottesdienst besuchen. Das Überraschungsmoment war ja bekanntlich schon für manche Überraschung gut gewesen. Röhrig machte Google-Maps auf und gab Sulzbach am Taunus als Ziel an.
–
Henry stöhnte, aber nur sehr leise. Die Tagesordnung des heutigen Pfarrkonvents war lang. Zuhause wartete ein Haufen Arbeit auf ihn. Seinen Kolleginnen und Kollegen musste es genauso gehen. Schließlich war Advent. Die aneinandergestellten Tische im Gemeindesaal der evangelischen Kirche in Schwalbach waren vereinzelt mit weihnachtlichen Servietten geschmückt, auf denen Teelichte in selbstgebastelten Sternen aus Goldfolie standen. Henry konnte sich nicht entscheiden, ob er die Dekoration rührend oder deprimierend finden sollte.
Der Dekan gab einen Überblick über die Situation des Dekanats, der im Wesentlichen darin bestand zu erläutern, wofür alles kein Geld im Haushalt vorhanden war. Henrys Dekanats-Kollegen, die um ihn herum saßen, boten jede Haltung, von aufmerksam-konzentriert bis zum Tiefschlaf, dar – wie ein junger Kollege mit kleinen Kindern aus Eschborn, der mit geschlossenen Augen und leicht abgesacktem Kinn gleichmäßige Atemgeräusche von sich gab. Er saß im toten Winkel des Dekans, und sein Nachbar hatte offenbar beschlossen, dem jungen Familienvater sein Schläfchen so lange zu gönnen, bis das Schnarchen allzu laut wurde.
Henry saß neben Peter Langhans aus Niederhöchststadt, der damit beschäftigt war, das Wachs des Teelichts zu kneten. Nach dem Dekan war ein Vortrag mit dem Titel „Mediation und Supervision – Streiten, aber richtig“ angekündigt. Das ist ja genau das Richtige für mich, dachte Henry und schloss eine Wette mit sich selbst, dass das Loblied auf den Streit als „reinigendes Gewitter“ innerhalb der ersten zwei Minuten des Vortrags angestimmt werden würde. Die Referentin war Pfarrerin und Supervisorin und hieß Dr. Eva-Maria Müller-Rohr und Stein.
Henry stieß Peter an und zischte zwischen den Zähnen: „Meinst du, die hat genug Namen?“, wobei er auf die Tagesordnung wies.
Peter las den Namen und zuckte zusammen. Er hatte sich am Teelicht verbrannt. „Ja, echt“, antwortete er, den verbrannten Finger im Mund, „entweder Eva oder Maria. Wenn die Eltern schon bei der Namensgebung so unentschlossen waren, will ich nicht wissen, wie die Erziehung ausgesehen hat.“
„Pfarrerin!“, mischte sich die Köppel aus Bad Soden ein, die auf Peters anderer Seite saß, „und Supervisorin und Frau Doktor! Ich wette, die hat seit ihrem Vikariat keine Gemeinde mehr von innen gesehen, sonst hätte sie keine Zeit für so einen Firlefanz.“
Plötzlich war der Raum erfüllt von einem Läuten, das nach Kuhglocken klang. Der Dekan brach mitten im Satz ab und kramte in seiner Tasche herum. Er zog ein Handy heraus und nahm den Anruf an.
„Das sollte mal einer von uns machen“, meckerte die Köppel. Sie hatte offenbar einen schlechten Tag.
„Im Rentamt!“ Der Dekan stand
Weitere Kostenlose Bücher