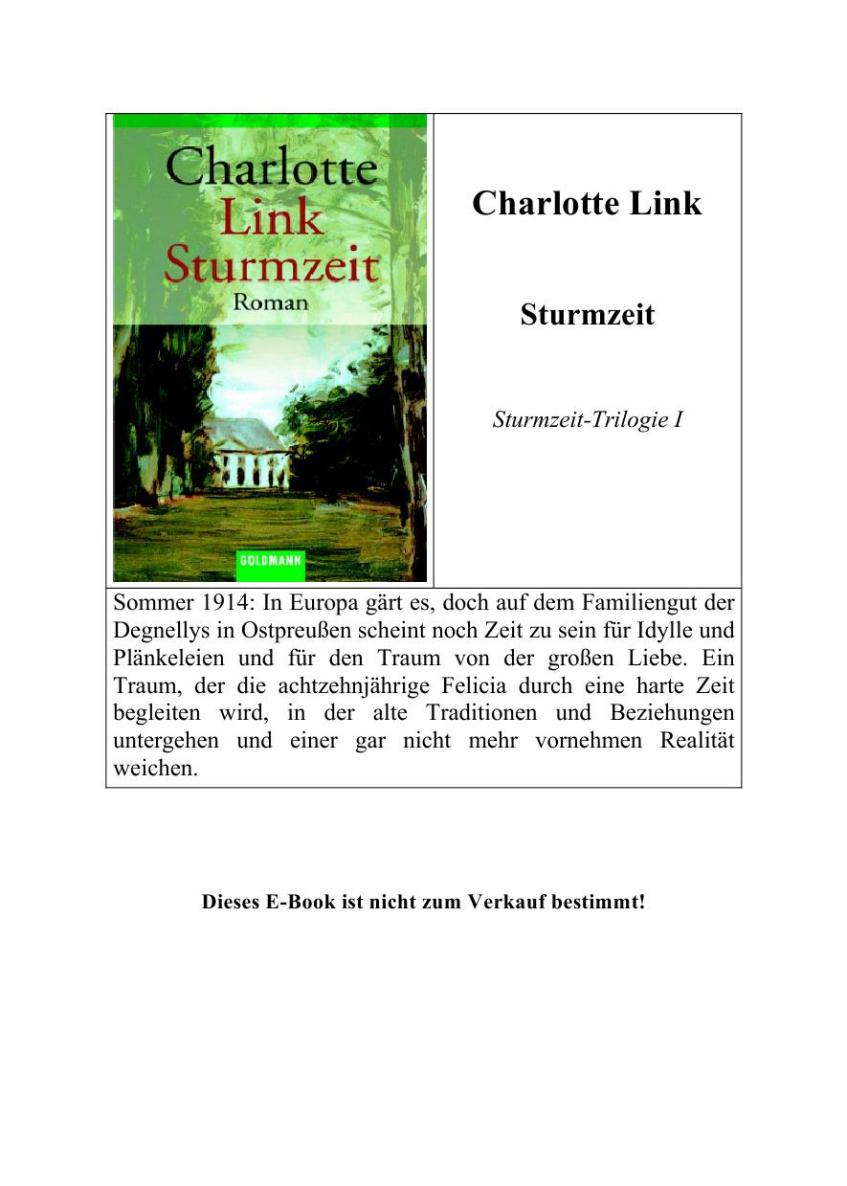![Sturmzeit]()
Sturmzeit
verqualmten Raum. Felicia trottete wutentbrannt hinterher. Der erste, den sie an einem Tisch gleich neben der Tür entdeckte, war Phillip. Er hielt sein Holzbein von sich gestreckt, hatte ein Glas Sekt vor sich stehen und eine in sich gekehrte brünette Frau neben sich sitzen, die ein buntes Zigeunergewand und klimpernden Silberschmuck trug und aussah, als sei sie eine Künstlerin. Wie sich herausstellte, malte sie Porträts, die ihr nachher niemand abkaufte, da sie unfähig war, auch nur etwaige Ähnlichkeiten mit dem Modell herzustellen.
Felicia wollte sofort umkehren, aber Phillip hatte sie schon gesehen und winkte ihr zu. Zögernd schob sie sich an seinen Tisch heran. Sie hatte geglaubt, daß er sie hassen mußte, aber seit Weihnachten war sie nicht mehr sicher. Auf Lulinn hatte nichts darauf hingedeutet, und sie war ihm dort aus dem Weg gegangen.
Ach was, ich kann ihm nicht mein Leben lang ausweichen, sagte sie sich und zwang sich, ihn so unbefangen anzulächeln wie früher.
Felicia wußte nicht, wo Phillips Scherben lagen; nicht allein bei Kat, da war sie sicher. Sie vermutete eher, irgendwo in Frankreich, irgendwo in diesem verdammten Krieg. Er hatte seine herzliche, unverkrampfte Kumpelhaftigkeit von früher verloren, sein Gesicht war starr geworden und verriet nichts von seinen Gedanken.
»Setz dich«, sagte er zu Felicia und musterte sie gleichmütig,»du siehst gut aus.«
»Danke«, murmelte Felicia und setzte sich. Die andere Frau lächelte ihr zerstreut zu. Phillip bestellte einen Martini für Felicia und begann irgendeine lustige Geschichte von einer Segelpartie auf dem Wannsee zu erzählen. Felicia betrachtete ihn. Er trug einen eleganten Anzug aus erstklassigem Stoff. Von Jo wußte sie, daß er mit einem bekannten Börsenmakler zusammenarbeitete; offenbar gingen die Geschäfte gut. Sie fragte ihn danach, und er berichtete ausführlich davon, jedoch stets mit dieser seltsamen Distanziertheit in den Augen. Felicia erzählte ebenfalls, und ehe sie es sich versah, sagte sie: »Ich werde demnächst nach Paris fahren und eine Modenschau von Coco Chanel sehen, und Tom Wolff wird...« Sie brach erschrocken ab. Wolff wird mich begleiten, hatte sie sagen wollen, aber in Phillips Gegenwart brannte ihr der Name wie Feuer auf der Zunge. Hastig trank sie ein paar Schlucke von ihrem Martini und sehnte sich weit fort.
»Was ist mit Wolff?« fragte Phillip freundlich. Felicia schob ihren Stuhl zurück und stand auf. »Er begleitet mich«, erwiderte sie gepreßt, »wenn... du mich jetzt entschuldigen...« Im gleichen Moment trat Maksim von hinten an sie heran, ließ seine Hände um ihre Taille gleiten und verschränkte sie auf ihrem Bauch.
»Hier sind Freunde von mir«, flüsterte er, »ich will dich ihnen vorstellen.«
Phillip beobachtete diese intime Geste mit leiser Irritation. Er und Maksim kannten einander flüchtig von früheren Sommern her, als sie beide Gast auf Lulinn gewesen waren. Sie nickten einander zu. »Verzeihen Sie, wenn ich nicht aufstehe«, sagte Phillip und wies auf sein Holzbein, »ein Andenken an jene letzten Kriegstage, als im Grunde schon alles verloren war, die Oberste Heeresleitung uns aber unbedingt noch in eine Schlacht hetzen mußte!«
Maksim hob die Augenbrauen. »Herr Generalfeldmarschall von Hindenburg ist jetzt unser Reichspräsident. Mehr Ehrfurcht bitte!«
Beide Männer grinsten. Dann reichte Phillip Felicia seine Karte. »Wir sollten uns öfter sehen, Felicia. Ruf mich an!«
»Ja«, murmelte Felicia.
Sie folgte Maksim an einen Tisch, wo eine Gruppe von Männern saß, etwas heruntergekommene, vergammelte Intellektuelle, zum Teil ehemalige Spartakisten aus dem Kreis um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Sie betrachteten Felicia mit indiskretem Interesse. »Ist das deine bourgeoise Freundin, Maksim?« fragte einer, und ein anderer setzte hinzu:
»Die so wahnsinnig viel Geld macht?«
Maksim lachte. Felicia war nicht in der Stimmung für solche Anzüglichkeiten; die Begegnung mit Phillip steckte ihr noch in den Knochen, und der lange, heiße Nachmittag voller Streit und Mißbehagen. Zum ersten Mal seit langem sehnte sie sich danach, allein zu sein.
»Wenn ich gehen soll...«, sagte sie brüsk. Einer der Männer nahm ihre Hand: »Hierbleiben!« befahl er. »Wir sind eineklassenlose Gesellschaft. Wir akzeptieren Sie!«
Felicia setzte sich. Die Männer sprachen über alte Zeiten, tranken und rauchten. Draußen ging die Sonne unter. Die sanfteren Farben des Abends legten sich
Weitere Kostenlose Bücher