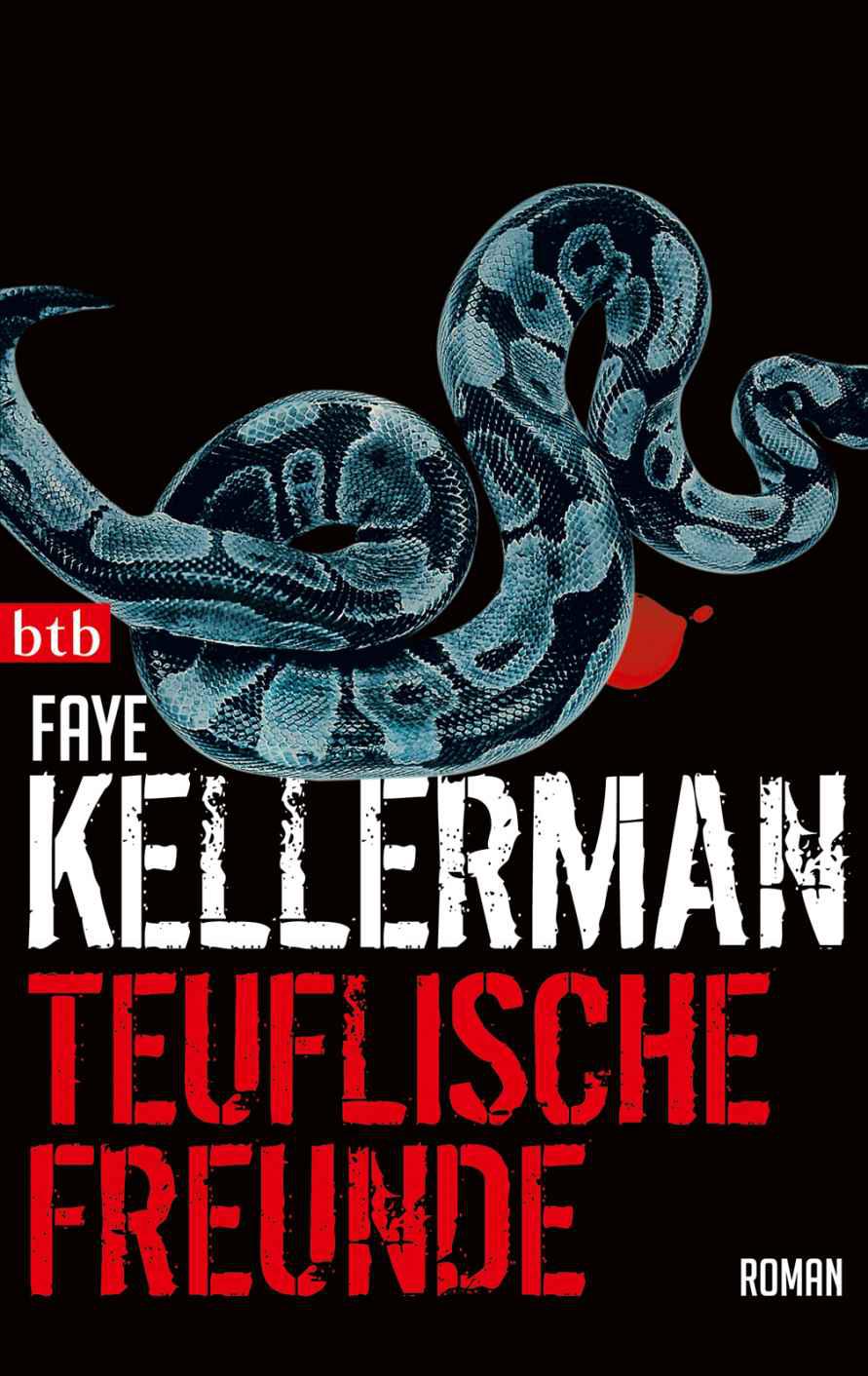![Teuflische Freunde: Roman (German Edition)]()
Teuflische Freunde: Roman (German Edition)
und sah zu, wie Gabe aus einem engen Parkplatz manövrierte und mit einem eleganten Schwung davonfuhr. Die meisten Jungs hatten so ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Hannah dagegen fuhr ständig irgendetwas um – Pfosten, Büsche, Briefkästen. War er ein Sexist? Vielleicht, aber er war viel zu eingefahren in seinen Eigenarten, als dass er sich darüber Gedanken machte.
Decker rief seine Lieblingskollegin zurück. »Was ist passiert?«
»Ich habe gerade einen Anruf von einem Streifenpolizisten bekommen«, sagte Marge. »Es gab einen weiteren Selbstmord.«
Die Nachricht erregte seine Aufmerksamkeit. »Etwa einer von Gregorys Freunden?«
»Das weiß ich noch nicht, weder ja noch nein, aber sie ist im Teenager-Alter. Myra Gelb – sie ging in die elfte Klasse auf der Bell and Wakefield.«
»Gütiger Himmel.« Decker steckte den Autoschlüssel ins Zündschloss. »Wie lautet die Adresse?«
Marge gab ihm die Anschrift durch. »Das ist einfach … furchtbar.«
Er startete den Wagen und fuhr los. Das Handy verband sich über Bluetooth mit der Freisprechanlage. »Ich bin unterwegs. Hast du schon in der Gerichtsmedizin angerufen?«
»Alle sind auf dem Weg hierher.«
»Wie hat sie es getan?«
»Ein aufgesetzter Schuss in den Kopf.«
»Wie Gregory Hesse?«
»Auf gespenstische Weise wie Gregory Hesse.«
13
Zwei Streifenwagen standen sich Motorhaube an Motorhaube gegenüber und blockierten die Straße für den Durchgangsverkehr. Ein Krankenwagen wartete ungefähr in fünfzehn Metern Entfernung. Decker trabte zum Tatort und nickte zwei Beamten zu, die außerhalb des gelben Absperrbands stationiert waren, bevor er sich unter dem Band durchschlängelte.
Der Wohnblock war aus Gips und Holz erbaut worden, und jede Wohneinheit hatte einen Balkon und Blick auf die Straße vor der Haustür. Familie Gelb wohnte im ersten Stock des dreigeschossigen Gebäudes.
Er ging durch die unverschlossene Tür und traf die Notärzte, die eine völlig verstörte, auf dem Sofa zusammengesunkene Frau behandelten. Sie trug eine graue Hose und eine rote Bluse, deren rechter Ärmel hochgekrempelt war, um der Manschette eines Blutdruckmessgeräts Platz zu machen. Neben ihr stand ein junger Mann, Mitte zwanzig, bekleidet mit Jeans und einem Sweatshirt der UCLA , und hielt ihre Hand.
Das Wohnzimmer ging ins Esszimmer über, und von dort aus gelangte man in die Küche. Decker fand Marge, die sich an den Küchentresen lehnte, ihren Notizblock vor sich aufgeschlagen, aber sie schrieb nichts hinein.
Sie sprach sehr leise. »Sie hat es in ihrem Zimmer getan.«
»Wie viele Schlafzimmer gibt es?«
»Zwei. Eins für die Tochter, eins für den Sohn. Er studiert an der UCLA , lebt aber noch zu Hause. Die Mutter ruht im Wohnzimmer auf einem Schlafsofa.« Marge stand kurz davor zu weinen. »Ich zeige dir, wo es passiert ist, wenn du das möchtest.«
»Wer bewacht den unmittelbaren Tatort?«
»Hosea Nederlander. Er wartet auf die Spurensicherung.«
»Warten wir noch kurz mit der Besichtigung der Leiche. Ich möchte erst ein Gefühl für die Familie bekommen.«
Still gingen sie zurück ins Wohnzimmer. Die Notärzte unterhielten sich leise miteinander. Die Mutter war Ende vierzig; ihre Augen waren gerötet, aber trocken. Sie saß steif da, während einer der Männer immer wieder ihren Blutdruck maß.
Ein Notarzt namens Lanie redete mit dem jungen Mann. »Ihr Blutdruck ist immer noch viel zu hoch. Wir müssen sie wirklich ins Krankenhaus fahren.«
»Ich gehe nirgendwohin«, sagte die Frau bestimmt. Ihr Blick blieb an Marge und Decker hängen. »Sind Sie von der Polizei?«
»Ja, das sind wir.« Decker stellte sich vor.
»Ich will nicht weg!«
»Mom –«
»Nein! Ich kann sie nicht alleinlassen! Das kann ich nicht!«
»Ich werde hierbleiben und mich um alles kümmern«, sagte der Sohn. »Aber das geht nicht, wenn ich mir auch noch um dich Sorgen machen muss.«
»Ich will nicht weg!« Die Hautfarbe der Frau war nur eine Nuance entfernt von der eines Geistes.
»Möchten Sie ein Glas Wasser trinken, Ma’am?«, fragte Marge.
»Das ist eine gute Idee«, meinte der Sohn.
Marge ging in die Küche. »Haben Sie einen Arzt, den wir für Sie anrufen können?«, fragte Decker.
»Mom«, sagte der Sohn, »bist du immer noch bei Dr. Radcliff?«
Die Frau antwortete nicht.
»Brian Radcliff«, sagte der Sohn. »Seine Nummer habe ich nicht.«
»Die finde ich heraus«, sagte Decker. »Ich könnte dafür sorgen, dass er Ihre Mutter im Krankenhaus
Weitere Kostenlose Bücher