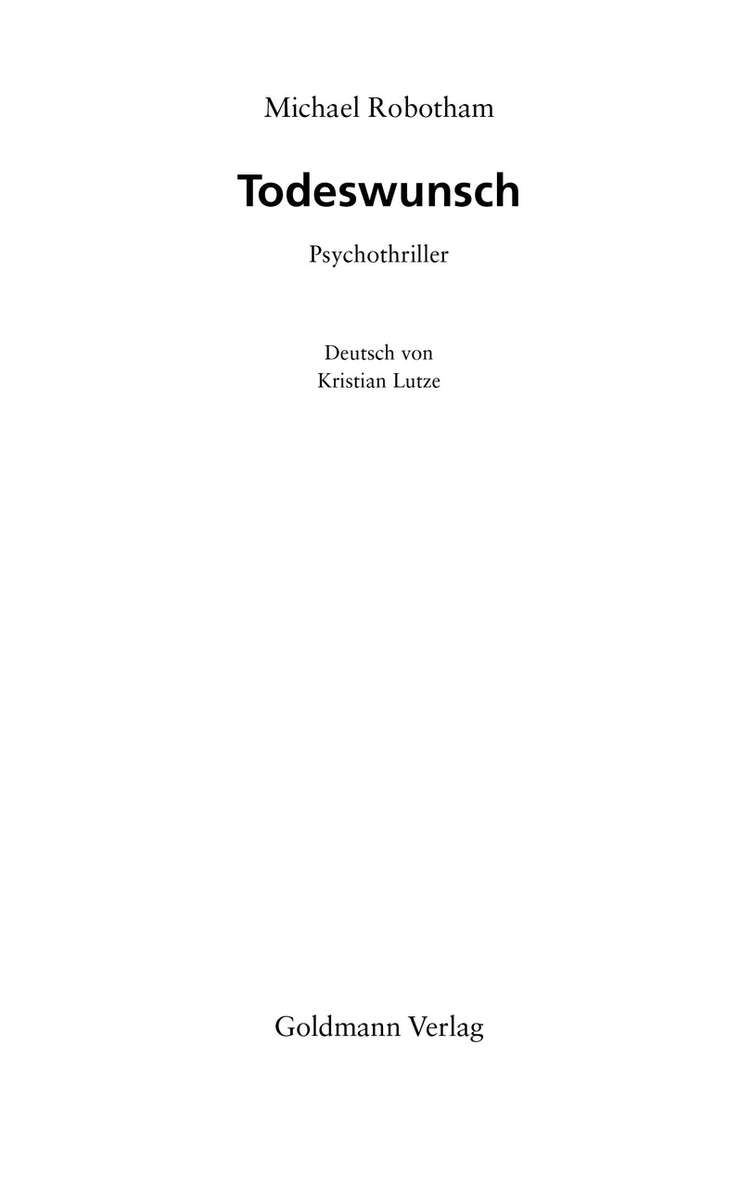![Todeswunsch - Robotham, M: Todeswunsch - Bleed For Me]()
Todeswunsch - Robotham, M: Todeswunsch - Bleed For Me
sie in den Flur getragen und ihnen gesagt, sie sollten nicht atmen.«
»Was war mit Vira?«
»Sie war schon im Flur. Ich weiß nicht, wie sie aus dem Zimmer gekommen ist. Sie rief nach Mama und Papa, aber ich konnte die beiden nicht mehr hören.«
Marco hebt den Blick. Im Gerichtssaal ist es so still, dass ich das Zittern in Juliannes Stimme hören kann, als sie übersetzt. Marco berichtet, wie er mit seinen jüngsten Schwestern im Arm zurück in die Dachkammer gestiegen ist. Er versuchte, das Fenster zu öffnen, aber es ließ sich nur etwa fünfzehn Zentimeter weit aufstemmen. Marco hob seine Schwestern an den Spalt, damit sie atmen konnten. Sie wechselten sich ab, doch es reichte nicht. Vira geriet in Panik und versuchte, nach unten zu rennen.
»Ich habe sie fallen hören«, sagt Marco mit einem Kloß im Hals. »Als ich sie gerufen habe, antwortete sie nicht. Ich hoffe, sie ist ohne Schmerzen gestorben …«
Eine Geschworene schluchzt. Es gibt keinen Ort, an dem man sich vor der rohen, betäubenden Emotion in Marcos Stimme verstecken kann. Er beschreibt, wie er mit einem Koffer so lange auf das Sicherheitsglas einschlug, bis die Fensterangeln brachen und er das Fenster auftreten konnte. Er wollte Danya aufs Dach heben, doch die Schräge war zu steil.
Stattdessen zog er das Bett unters Fenster und kletterte nach draußen. Dann beugte er sich in die Öffnung und forderte Danya auf, Aneta, die Vierjährige, hochzuheben, damit er sie hinausziehen konnte, aber Danya war nicht kräftig genug.
»Sie hat es versucht, aber sie bekam keine Luft. Sie konnte nichts sehen … ich konnte sie nicht herausziehen. Ich konnte nicht wieder reingehen … Aneta … Danya …. «
Marco ringt nach Luft, als wollte er immer noch versuchen,
ihnen zu helfen. Richter Spencer fragt, ob er eine Pause einlegen möchte.
Als ich meinen Blick über die Besucherränge gleiten lasse, fällt mir eine Frau auf, die mit gesenktem Kopf allein sitzt und etwas im Schoß hält. Sie trägt mehrere Schichten nicht zueinander passender Kleidungsstücke, klobige Schuhe und Wollstrümpfe. Als sie sich auf ihrem Platz sanft vor und zurück wiegt, sehe ich, dass sie einen zerschlissenen Teddy mit einem roten Halsband umklammert. Ein Maskottchen.
Eine Mutter, denke ich, vielleicht von einem der Angeklagten. Brennans Mutter ist laut Ruiz an einer Überdosis gestorben, trotzdem erkenne ich eine Ähnlichkeit in der Form ihres Gesichtes und ihren schmalen Lippen.
Die Wahrheit sickert in die Stille. Das muss Rita sein, Novaks Schwester.
Haarsträhnen fallen ihr ins Gesicht, und ich ertappe mich dabei, ihre im Schatten liegenden Augen zu suchen und mich zu fragen, an wie viel aus der Zeit als Zwölfjährige in den Straßen von Belfast sie sich erinnert. Ihre Miene wirkt gehetzt, ein Blick, den ich in Kinderheimen und Sprechzimmern häufig gesehen habe. Geschlagen. Gebrochen. Argwöhnisch. Junge Vergewaltigungsopfer schauen nicht mit diesem sanften, weichen, zuversichtlichen Blick in die Welt, der sagt: »Ist es nicht toll, ich zu sein.« Stattdessen sind sie permanent auf der Hut, doch nicht einmal das kann sie vor dem Schmerz schützen. Er steht in ihren Gesichtern geschrieben.
Richter Spencer hat eine Verhandlungspause verkündet. Er erhebt sich, und der Saal folgt ihm. Novak Brennan wendet sich von der Anklagebank zur Besuchergalerie und sucht Augenkontakt mit Rita. Irgendetwas vermittelt sich zwischen den beiden; es ist weniger ein Lächeln als tiefes Verständnis, als ob Novak ihr auf irgendeine Weise die Schulter getätschelt oder die Hand gedrückt hätte. Zuneigung strahlt in ihrem Gesicht auf. Novak wird aus dem Saal geführt.
Im selben Moment geht die Tür zur Besuchergalerie auf. Ein Mann taucht auf, der auf Rita wartet. Er ist groß, mit glattem schwarzem Haar, das im Licht der Deckenlampen glänzt. Er trägt Jeans und eine Lederjacke, aber es ist nicht seine Kleidung, die ihn auffällig macht. Die Knochen seines Gesichtes sehen aus wie ein Metallgerüst unter seiner blassen Haut, und Tränen aus Tinte tropfen aus seinen Augen auf seine Wangen.
Das ist der Mann, den Stan Keating beschrieben hat. Der Mann, den ich in der Minicab-Zentrale und vor dem Restaurant gesehen habe. Ruiz hat ihn ebenfalls bemerkt. Obwohl er keine Reaktion zeigt, kann ich förmlich spüren, wie er innerlich einen Schritt zurück und sich ein bisschen kleiner macht.
Die Tür fällt zu. Die beiden sind weg.
Ruiz hat sich nicht gerührt.
»Willst du ihm folgen?«, frage
Weitere Kostenlose Bücher