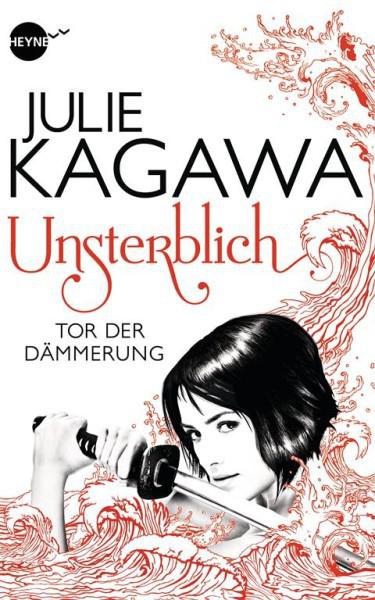![Tor der Daemmerung]()
Tor der Daemmerung
hing ich nicht mehr kopfüber, aber einer meiner Arme schien immer noch gebrochen zu sein. Obwohl man das nur schwer sagen konnte – mein ganzer Körper war misshandelt, geheilt und dann wieder systematisch auseinandergenommen worden. Nur eine Sache nahm ich ganz deutlich wahr: den Hunger.
Sarren lächelte. »Hungrig, wie? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, es sind jetzt schon vier Tage. Moment – doch, das kann ich schon! Vor den Experimenten haben sie uns auch immer hungern lassen, damit wir auch wirklich jede Kreatur angriffen, die sie zu uns rein scheuchten. Wusstest du das?«
Ich antwortete nicht. Ich hatte während meiner ganzen Gefangenschaft kein Wort gesprochen, und würde jetzt auch nicht damit anfangen. Nichts von dem, was ich sagen konnte, würde diesen Wahnsinnigen umstimmen. Er suchte nur nach Möglichkeiten, mich zu quälen und meinen Widerstand zu brechen. Und diese Genugtuung würde ich ihm nicht verschaffen, nicht, solange ich meinen Verstand noch beisammen hatte.
In dieser Nacht konnte er mich foltern, soviel er wollte, nichts davon würde vergleichbar sein mit den Schmerzen, die ich bereits durchlitten hatte: die Schreckensvisionen von meinen beiden Abkömmlingen, die sich gegenseitig töteten, ohne dass ich eingreifen konnte. Zwei Kinder, die ich enttäuscht hatte.
Allison, vergib mir. Ich wünschte, ich hätte dich besser vorbereiten können. Doch wer hätte gedacht, dass du so weit von deinem Geburtsort entfernt auf deinen Bruder im Blute treffen würdest?
»Du scheinst heute Nacht nicht ganz bei der Sache zu sein, alter Freund.« Noch immer lächelnd griff Sarren zum Skalpell und hob es an mein Gesicht. Seine Zunge schnellte vor und fuhr über das glänzende Metall. »Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir deine Aufmerksamkeit nicht wieder in die richtigen Bahnen lenken können. Angeblich schmeckt Blut ja am besten, wenn es direkt von der Klinge kommt. Warum finden wir nicht heraus, ob das stimmt?«
Ich schloss die Augen und wappnete mich. Viel länger würde ich nicht überleben. Schon jetzt spürte ich, wie sich mein Verstand den Schmerzen und dem Wahnsinn zu ergeben suchte. Mein einziger Trost bestand darin, dass Sarren mich zuerst gefunden hatte und ich das volle Ausmaß seines Hasses zu spüren bekam, sodass meine Abkömmlinge vor seinen Fängen sicher waren.
Dann durchschnitt die Klinge meine Haut und jeder klare Gedanke zerfloss und wurde zu reinem Schmerz.
»Kanin!«
Mein Mund war voller Sand, er drang in meine Nase und kratzte in der Kehle. Spuckend und hustend setzte ich mich auf und wühlte mich durch die dicke Erdschicht, bis ich an die Oberfläche kam.
Zeke lehnte an einem halb versunkenen Schienenstrang, sprang nun aber hastig auf. Verwirrt sah ich mich um und versuchte mich daran zu erinnern, wo ich eigentlich war. Ein paar Meter weiter rollten kleine Wellen auf einen weißen Strand und zogen sich zischend in den See zurück. Hinter uns verdeckten Chicagos marode Wolkenkratzer den Himmel und drohten, in den Sand zu stürzen.
Nach und nach kehrte die Erinnerung an letzte Nacht zurück. Zeke und ich waren hinter der Brücke auf die anderen gestoßen, genau dort, wo er sie zurückgelassen hatte. Sie saßen in einem Van, der genauso aussah wie das Gefährt, mit dem sie entführt worden waren. Wenige Minuten vor Sonnenaufgang waren wir noch über die Straßen gerast und hatten versucht, so viel Abstand wie möglich zwischen uns und die Banditen zu bringen. Dabei waren wir hier am Ufer gelandet. Getrieben von dem Drang, mich zu schützen, hatte ich mich hastig in den Sand eingegraben, und nur Sekunden später muss die Sonne über dem Wasser aufgegangen sein, denn ich war sofort weg.
»Alles klar?«, fragte Zeke. Seine Haare wehten im Wind. Er sah etwas besser aus, weniger blass, und trug eine warme Jacke über seinen ausgefransten Klamotten. »Wieder Albträume gehabt?«
»Ja«, murmelte ich, obwohl ich wusste, dass es kein Traum gewesen war. Diese Bilder kamen von Kanin, und er steckte in Schwierigkeiten. »Wo sind die anderen?«, erkundigte ich mich. »Geht es ihnen gut?«
Zeke zeigte auf das Haus hinter uns. Neben dem Eingang stand der Van, an den Reifen häufte sich Sand auf. Immer wieder vertrieb der Wind den feinen Belag und legte den Asphalt darunter frei. »Caleb ist erkältet und Teresa hat sich den Knöchel verstaucht«, erklärte er, »aber ansonsten geht es ihnen gut, zumindest körperlich. Es grenzt an ein Wunder, dass keiner von
Weitere Kostenlose Bücher