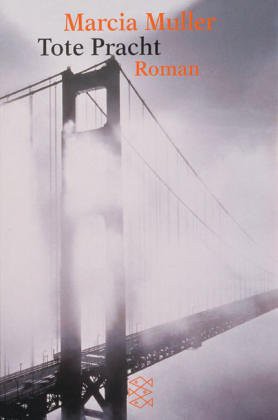![Tote Pracht]()
Tote Pracht
Austernbänke lag.
Ganz am Ende des Anlegestegs saß ein
Mann — groß, dünn, mit schwarzem Haar, das bis auf die Schultern seiner
ausgewaschenen Drillichjacke herunterfiel — und schaute über die Bucht in
Richtung Hog Island. Ich näherte mich ihm, wobei ich die Stellen vermied, wo
die Bretter morsch waren oder ganz fehlten. Der Steg schwankte unter der Last
meines Gewichts. Der Mann wandte den Kopf und beobachtete mich.
Auf den ersten Blick wirkte er völlig
normal, aber als ich näher kam, sah ich seine Augen. Sie waren schwarz und wie
tot — Höhlen, in denen kein Feuer mehr brannte und nur noch Asche lag. Er blieb
stumm, als ich vor ihm stand, beobachtete mich ohne Interesse oder Neugier. Ich
fragte: »Sind Sie D. A. Taylor?« Er nickte und schaute wieder auf die Bucht
hinaus.
Der Mann lebte in einer anderen Welt,
wie Ross richtig gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob andere zu jener Welt Zutritt
hatten, aber ich mußte versuchen, an ihn heranzukommen. Ich setzte mich an den
Rand des Stegs, zog die Knie an und legte die Arme um sie herum. Taylor
würdigte mich keines Blickes.
»Das ist eine schöne Insel dort
drüben.«
Keine Antwort.
»Ich frage mich, wie es wäre, dort zu
leben.«
Nun wandte er mir seine eigenartigen
Augen zu. Ich glaubte, tief unten ein Flackern wahrzunehmen, aber es konnte
auch nur das einfallende Licht sein. »Irgendwann werde ich es wissen«, sagte
er. Seine Stimme war sanft, die Silben klangen weich.
»Tatsächlich? Wollen Sie dort
hinziehen?«
Wieder schaute er zur Insel hinaus.
Nach einer langen Weile fragte er: »Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Sharon McCone. Ich komme
gerade von Libby Ross.«
»Libby. Libby mit den schönen
veilchenblauen Augen.« Er hielt inne und fügte dann hinzu: »Libby mit der bösen
Zunge.«
»Nach dem, was sie mir erzählt hat,
sind Sie Freunde.«
»Freunde können grausam sein, wenn sie
die Wahrheit sagen.« Nach meiner Begegnung mit seinen Verwandten überraschte
mich seine gebildete, etwas förmliche Sprechweise mehr als seine plötzliche
Klarheit. Ich hatte andere Leute wie Taylor gekannt: Drogenabhängige, die in
einem Moment völlig vernünftig waren und dann plötzlich in unzusammenhängendes
Gefasel und langes Schweigen verfielen.
»Worüber sagt Libby die Wahrheit?«
fragte ich.
Schweigen.
Ich brach es nicht sofort und
beobachtete ein Fischerboot, das gerade die Insel umschiffte. Gerüche stiegen
von den Austernbänken auf — brackig, fischig — und wurden von der kühlen Brise
davongetragen. Schließlich fragte ich: »Und was ist mit Perry Hilderly — hat
auch er die Wahrheit gesagt?«
Taylor wandte langsam den Kopf. Dieses
Mal sah ich das Flackern in seinen Augen ganz deutlich. »Perry glaubte
bedingungslos an die Wahrheit. Er hatte hohe Ideale. Die Unverletzlichkeit des
Lebens ging für ihn über alles. Ich habe zu ihm aufgeschaut und ihn geliebt wie
einen Bruder. Er war ein besserer Mensch als ich, als wir alle.«
»Und Jenny Ruhl?«
Ich hatte gedacht, daß nichts etwas
ändern könne an seinem tranceähnlichen Zustand, aber als ich diesen Namen
nannte, ging eine Welle des Schmerzes über sein Gesicht. »Jenny. So viele Jahre
schon tot. Es war so unnötig. Alles war so unnötig.«
»Was alles?«
Er schaute auf seine Finger, die auf
den Oberschenkeln seiner Jeans ausgebreitet lagen.
»Wie steht es mit Tom Grant?« fragte
ich.
»Wer ist das?«
»Erinnern Sie sich nicht mehr an ihn?
Thomas Y. Grant?«
»Nein. Aber es gibt vieles, an das ich
mich nicht mehr erinnere. Nur die falschen Sachen gehen mir nicht aus dem Kopf.
Nur die falschen nicht.«
»Schlimme Sachen?«
»Sehr schlimme. Ich kann sie einfach
nicht abschütteln.«
»Erzählen Sie mir davon.«
Er schüttelte heftig den Kopf; Strähnen
seiner langen, glatten Haare wirbelten durch die Luft und fielen wieder auf
seine Schultern.
Bevor er sich völlig in sich zurückzog,
kam ich auf das Thema Hog Island zurück. »Wann wollen Sie dort hingehen?«
fragte ich und deutete in Richtung Insel.
Sein Blick folgte meiner Hand. »Wenn es
mir hier zuviel wird. Bis jetzt geht es noch. Sie wissen, daß ich trinke?«
»Ja.«
»Libby hat es Ihnen natürlich erzählt.
Sie hat Ihnen auch von den Drogen erzählt. Das stimmt schon alles. Sie ist an
mir verzweifelt, aber sie versteht. Meine Frau versteht es nicht; ihre
Verzweiflung mit anzusehen, tut weh. Wenn es zu schmerzlich wird, gehe ich.«
»Und was wollen Sie dort tun?«
»Frieden haben.«
Es wurde mir klar, daß der
Weitere Kostenlose Bücher