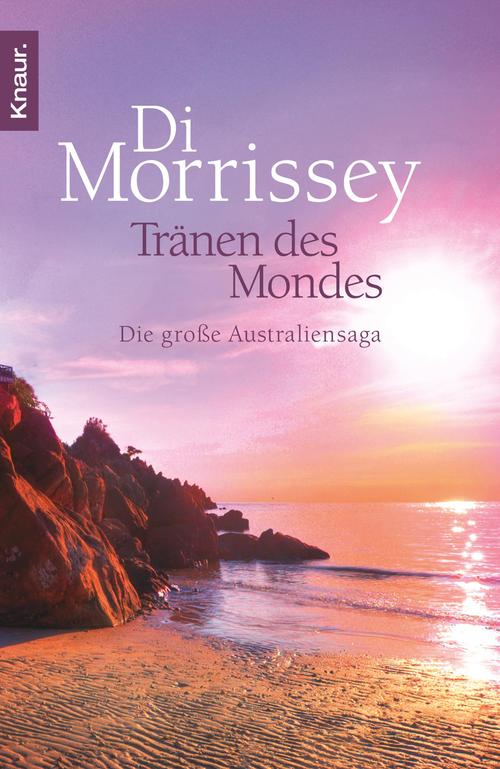![Tränen des Mondes]()
Tränen des Mondes
die kleine Gruppe von Frauen wieder zur Missionsstation auf; sie liefen im ausdauernden Schritt erfahrener Wanderer. Bei einem jungen Aborigine, der den kümmerlichen Gemüsegarten bearbeitete, blieben sie stehen und fragten nach der Begrüßung, wo Maya wäre. Er schüttelte den Kopf und berichtete ihnen in ihrer Sprache, sie sei weggeschickt worden. Weit weg. Um bei weißen Leuten zu wohnen.
Die Frauen setzten sich, um die Sache erst einmal unter sich zu bereden. Es war bekannt, daß Kinder aus ihren Familien gerissen, auf Missionsstationen ausgebildet und dann zu Weißen geschickt wurden, um für sie zu arbeiten. Doch die Frauen hatten nicht erwartet, daß das mit ihrer Maya passieren könnte. Die Nachricht war schmerzvoll für sie.
Bruder Frederick kam und setzte sich zu ihnen. Er versuchte zu erklären, warum er zugelassen hatte, daß der Priester, der zu Besuch gekommen war, Maya zu einer weißen Familie mitnahm. Wieviel mehr Möglichkeiten sich für Maya dort bieten würden, die nun sicher ein besseres Leben hätte. Schließlich war sie allem Anschein nach auch vorher schon unter Weißen aufgewachsen. Und sie könnte fast als Weiße gelten, erklärte er. Das bedeutete ihrer Familie herzlich wenig. Sie war, was sie war: eine von ihnen. Maya hatte alle Zeremonien durchlaufen und ihr Muscheltotem in Form einer Halskette bekommen. Sie war in die
Traumzeit
eingeführt worden, das würde man ihr nie wieder nehmen können.
Die Frauen wollten wissen, wann Maya zurückkommen würde, wann diese Arbeit bei den Weißen beendet wäre, doch darauf konnte ihnen der Pater keine Antwort geben. »Maya hat ein neues Heim gefunden, ein neues Leben. Das ist für sie das Beste.«
Da brachen die Frauen in lautes Klagen aus, als wäre Maya tot. Bruder Frederick ging zum Beten in die Kirche. Er war sicher, richtig gehandelt zu haben, Maya würde in einem christlichen Haushalt aufwachsen und die Moral und den Glauben ihrer neuen weißen, katholischen Familie annehmen. Irgendwann würde sie das harte Nomadenleben vergessen und die Rituale und Mythen, die sie im Busch erlernt hatte, kämen ihr dann wie Märchen aus der Kindheit vor. Er versuchte, sich gegen das Wehgeschrei taub zu stellen, während er für Maya und diese verlorenen Seelen betete, die sich ihre Familie nannten.
In ihrem kleinen weißen Zimmer kniete Maya, die sich in dem ungewohnten langen Baumwollnachthemd und den Unterhosen sehr unwohl fühlte, pflichtschuldig neben ihrem Bett und wiederholte laut das Vaterunser, wie ihr befohlen war. Als sie sich dann zwischen die Bettlaken gelegt und ihre neue ›Mutter‹ das Licht gelöscht hatte, sang sie sich leise die Lieder vor, die sie am Lagerfeuer gelernt hatte. Darin fand Maya einen kleinen Trost und die Hoffnung, daß sich auch dieser Abschnitt ihres Lebens bald wieder ändern würde. In ihrem kurzen Leben hatte sie gelernt, daß Freude und Geborgenheit nicht von Dauer waren, doch sie gab die Hoffnung nie auf, daß sie irgendwo den richtigen Platz im Leben finden würde. Und sie klammerte sich an die Erinnerung an die liebevollen Arme und die sanfte, leise Stimme ihrer Mutter und an einen lachenden Mann, der laut sang, während er sie kitzelte und mit ihr schäkerte.
Gilbert Shaw und Olivia beschlossen, sich weitere wohltätige Einrichtungen anzusehen, und brachen zum Kloster von New Norcia auf.
Es war eine lange Reise, doch Olivia genoß sie. Die Zugfahrt von Perth aus verlief angenehm, Olivia hatte Gelegenheit, sich ungestört und ausgiebig mit Gilbert zu unterhalten. Olivia schäumte über vor Begeisterung für ihr bescheidenes Mädchenheim, und Gilbert betrachtete sie lächelnd.
»Warum sehen Sie die ganze Zeit so belustigt aus?« fragte Olivia. »Wenn ich es nicht besser wüßte, würde ich glauben, Sie sehen in mir ein verwöhntes Kind.«
»Ich freue mich so über Ihre Lebensenergie, Olivia. Sie nehmen alles so schwungvoll in Angriff, stürzen sich kopfüber in Ihre Aufgabe, scheuen vor nichts zurück. Ihre Gesellschaft ist sehr anregend, ein richtiges Lebenselixir.« Er drückte ihr die Hand. »Sie schenken mir das Gefühl, daß ich immer noch etwas zu geben habe.«
»Das stimmt ja auch, Gilbert! Ich bin so stolz auf die Arbeit, die Sie leisten. Und weil Sie mir die Freiheit lassen, so zu empfinden und zu handeln, wie es mir entspricht, fühle ich mich wohl.« Sie schwieg einen Moment. »Ich spüre Geborgenheit, und daß ich großes Glück habe, bei Ihnen zu sein.«
»Der Glückliche bin ich. Sie
Weitere Kostenlose Bücher