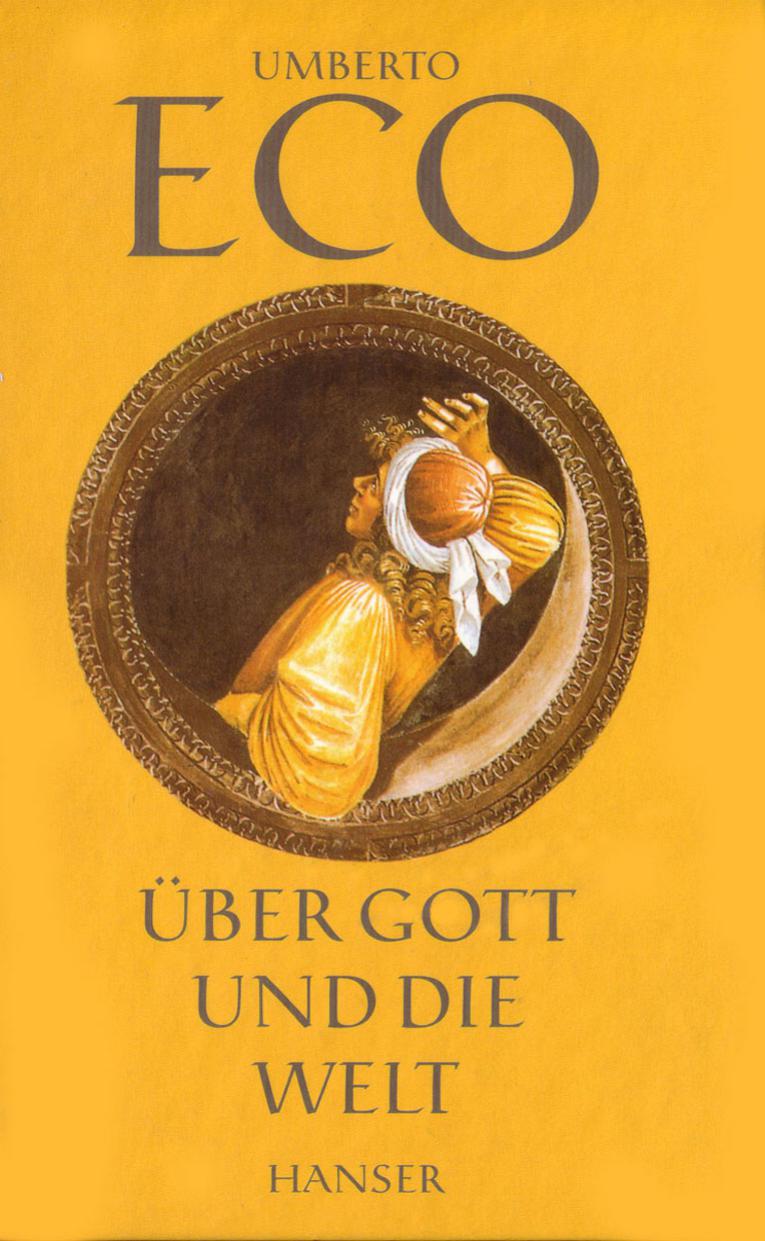![Über Gott und die Welt]()
Über Gott und die Welt
meine, es ist geboten): Dies ist eins jener Fotos, die in die Geschichte eingehen werden und die man in zahllosen Büchern abdrucken wird. Die Wechselfälle unseres Jahrhunderts fi nden ihr Resümee in wenigen exemplarischen Fotos, die Epoche gemacht haben: die ungeordnete Menge, die auf den Platz hinausströmt, am ersten der »zehn Tage, die die Welt erschütterten«; der getötete Milizionär von Robert Capa; die Marines, die das Sternenbanner auf der Pazifi kinsel hissen; der vietnamesische Gefangene, dem ein Revolver an die Schläfe gedrückt wird; Che Guevara zerschossen auf einem rohen Kasernentisch. Jedes dieser Bilder ist zu einem Mythos geworden und hat eine Serie von Diskursen exemplarisch verdichtet. Es hat den Einzelfall über-stiegen, es spricht nicht mehr von diesem oder jenem Individuum, sondern es drückt Begriffe aus. Es ist singulär, aber es verweist zugleich auf andere Bilder, die ihm vorausgegangen oder gefolgt sind und es nachgeahmt haben. Jedes dieser Fotos kommt uns vor wie ein ganzer Film, den wir gesehen haben und der wiederum auf andere Filme verweist, die es zitieren. Manchmal ist es dann auch kein Foto mehr, sondern ein Gemälde oder ein Plakat.
Was hat nun das Foto des Mailänder Schützen »gesagt«? Ich glaube, es hat mit einem Schlag, ohne lange diskursive Umwege zu benötigen, etwas aufgedeckt, was in vielen Diskursen unausgesprochen umging, aber durch Worte nicht ausdrückbar war. Das Foto glich keinem der Bilder, in denen sich seit mindestens vier Generationen die Idee der Revolution versinnbildlicht hatte. Es fehlte das kollektive Moment: Was hier in traumatischer Weise wiederkehrte, war die Figur des heroischen Einzelkämpfers, des Helden. Und dieser einzelne Held war nicht die Heldenfi gur der revolutionären Ikonographie, die den einzelnen Menschen, wenn sie ihn ins Bild brachte, immer als Leidenden dargestellt hat, als Opfer – eben als sterbenden Milizionär oder toten Che.
Hier hatte der einzelne Held die Pose und die erschreckende Isoliertheit des einsamen Helden in amerikanischen Polizeifi lmen (die Magnum des Inspektors Callaghan) oder des Revolverhelden im Western (der nicht mehr das Idol einer Generation ist, die sich als Indianer versteht).
Nein, dieses Bild evozierte andere Welten, andere Erzähl-und Darstellungstraditionen, die nichts mit der proletarischen Tradition zu tun haben, mit der Idee des Volksaufstandes und des Kampfes der Massen. Es erzeugte mit einem Schlag ein Abwehr-und Abkehrsyndrom. Die Moral, die es sinnfällig auf den Begriff brachte, hieß: Die Revolution ist woanders, und sollte sie jemals kommen, dann nicht durch »individuelle« Gesten wie diese.
Für eine Kultur, die längst gewöhnt ist, in Bildern zu denken, war dieses Foto nicht die Beschreibung eines Einzelfalles (denn es geht nicht darum, wer der Schießende war, und das Foto trägt auch nichts zu seiner Identifi zierung bei): Es war ein schlagendes Argument. Und es saß.
Gleichgültig, ob es gestellt war (und somit eine Fälschung ist) oder authentisches Zeugnis einer bewußten Verwegenheit, ob von einem Profi gemacht, der den richtigen Zeitpunkt, das Licht und den Ausschnitt kalkuliert hat, oder gleichsam von selbst entstanden, als gelungener Schnappschuß eines Amateurs: Im Augenblick seines Erscheinens hat sein Lauf durch die Kommunikationsprozesse begonnen. Und wieder einmal sind das Politische und das Private von den Wirkfäden des Symbolischen durchdrungen worden, das sich, wie immer, als Wirklichkeitsproduzent erwiesen hat.
(29. Mai 1977)
Das Lendendenken
Kürzlich erschien hierselbst an dieser Stelle ein schöner Aufsatz von Luca Goldoni über die Mißhelligkeiten derer, die sich aus modischen Gründen in Blue Jeans zwängen und dann nicht mehr wissen, wie sie sich hinsetzen sollen und wie den äußeren Reproduktionsapparat verteilen. Mir scheint, das von Goldoni angeschnittene Problem ist reich an philosophischen Refl exionen, die ich hier meinerseits mit der größten Ernsthaftigkeit ein Stück weiterverfolgen möchte – denn keine Alltagserfahrung ist zu niedrig für einen denkenden Menschen, und es wird Zeit, die Philosophie nicht nur vom Kopf auf die Füße zu stellen, sondern auch auf die Lenden.
Ich habe schon Jeans getragen, als das noch sehr wenige taten und jedenfalls nur in den Ferien. Ich fand und fi nde sie sehr bequem, vor allem auf Reisen, da es bei ihnen keine Probleme mit Bügelfalten, Flecken und Rissen gibt. Heutzutage werden sie auch um der
Weitere Kostenlose Bücher