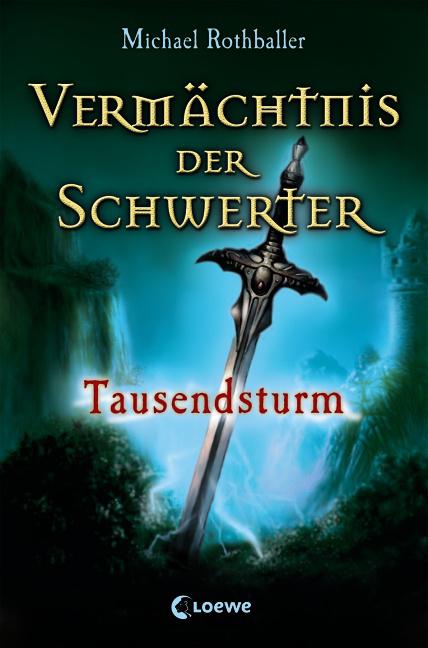![Vermächtnis der Schwerter Tausendsturm]()
Vermächtnis der Schwerter Tausendsturm
ihn das dichte Unterholz an einem raschen und vor allem geräuschlosen Fortkommen hindern.
Daher blieb Rai genügend Zeit, die ehemaligen Sklaven, aus denen sich ihre kleine Truppe zur Bewachung der Straße zusammensetzte, ein wenig genauer zu betrachten. Alle schienen die ungewohnten Schwerter in ihren Händen und die teilweise viel zu großen Brustpanzer mit merklichem Stolz zu tragen. Sie hielten nicht länger ihre Blicke angstvoll zu Boden gerichtet wie noch vor Kurzem, als Rai ihnen bei seiner Ansprache im Bergwerk gegenübergestanden hatte. Der Sieg über die Gardisten erfüllte sie mit neuer Zuversicht, denn ihr Schicksal lag das erste Mal seit Langem wieder in ihrer eigenen Hand. Der Stolz auf das Erreichte und die Furcht, es wieder zu verlieren, machte sie unbeugsam. Sie würden sich von niemandem den grenzenlosen Himmel über ihren Köpfen und den lebendigen Wald ringsherum wieder nehmen lassen, denn sie hatten mit ihrem Blut dafür bezahlt, diese beinahe vergessenen Wunder der Oberwelt zurückzuerobern. Die Männer würden ihre neu gewonnene Freiheit bis zum Letzten verteidigen, das stand außer Frage.
Während dieser Überlegungen fiel Rai auf, dass es sich bei einem der Minenarbeiter nicht um einen Mann handelte, sondern um die bemerkenswerte Frau, deren mutigem Beispiel alle anderen Freiwilligen gefolgt waren. Es freute den Dieb, dass sie den Kampf um den Turm überlebt hatte, und er war versucht, sie anzusprechen, um sie ein wenig über ihre Herkunft und nicht zuletzt ihr auffälliges Interesse für Arton zu befragen. Indes trieb ihn seine Neugier dazu, zunächst ein anderes Geheimnis zu ergründen, nämlich das um Kawrins Vorleben.
Unvermittelt überfiel er seinen Begleiter daher erneut mit der Frage nach dessen Vergangenheit. Wieder begann Kawrin, sich zu winden und suchte nach einer Ausflucht, um dieses für ihn so unliebsame Thema nicht weiter vertiefen zu müssen. Doch Rai ließ nicht locker.
Schließlich wurde der hochgewachsene Seewaither zunehmend ungehalten: »Warum soll ich dir etwas von mir erzählen, wenn du aus deiner eigenen Vorgeschichte immer ein großes Geheimnis machst?«
»Du willst meine Geschichte hören?«, erwiderte Rai ebenso gereizt. »Nun gut. Das ist schnell erledigt. An meine Eltern kann ich mich nicht erinnern. Solange ich denken kann, lebe ich schon auf der Straße und von der Hand in den Mund. Einzige Ausnahme war eine kurze Zeit, als ich als Küchenjunge bei einer wohlhabenden Familie arbeiten durfte. Eine Magd dort hatte Mitleid mit mir und sorgte dafür, dass ich eine Anstellung erhielt. Ich wurde jedoch wegen Unehrlichkeit hinausgeworfen, und seither habe ich die Dieberei zu meinem Haupterwerb gemacht. Und in Andobras bin ich letztlich gelandet, weil ich ein altes Schwert aus dem Palast von Tilet entwendet habe.« Er machte eine abschließende Handbewegung. »So, das war alles. Jetzt bist du dran.«
Kawrin stand staunend vor dem kleinen Tileter, während er das Gehörte zu verarbeiten suchte. »Du bist in den Palast von Tilet eingebrochen?«, wiederholte er ungläubig.
»Ja, ja, und ich habe dort nichts weiter als ein dummes Schwert gestohlen«, fügte Rai ungeduldig hinzu, »das mir mittlerweile auch schon wieder abhandengekommen ist. Aber wir wollten hier nicht über mich reden. Also, warum bist du nach Andobras geschickt worden?«
Überrumpelt setzte sich der Blondschopf auf einen nahen Baumstumpf. Er senkte den Kopf und starrte eine Weile zu Boden.
Als Rai ihn gerade ein weiteres Mal vehement dazu auffordern wollte, im Gegenzug nun die eigene Geschichte preiszugeben, begann Kawrin, leise zu sprechen, ohne dabei einen Blick ins Gesicht seines Zuhörers zu riskieren: »Ich komme aus der Gosse, so wie du.« Seufzend fuhr er sich durchs verfilzte Haar. »Ohne Eltern oder ein Zuhause schlug ich mich auf den Straßen Seewaiths durch, versuchte nichts weiter, als irgendwie am Leben zu bleiben. Eines Tages fand ich einen toten Edelmann in einer Seitengasse. Aus seiner Kehle ragte ein Messer. Nicht so ein einfaches Ding zum Brotschneiden, es war ein wundervoll gearbeitetes Stück mit geschnitztem Griff und zweischneidiger Klinge. Deshalb nahm ich es an mich. Bald stellte ich fest, wie perfekt ausgewogen die Waffe war und dass sie sich hervorragend zum Werfen eignete. Es dauerte nicht lange, da verdiente ich meinen Lebensunterhalt mit allerlei Kunststücken, die ich mit dem Messer vollführte. Ich konnte damit auf zehn Schritt die Mitte einer Kupfermünze treffen.
Weitere Kostenlose Bücher