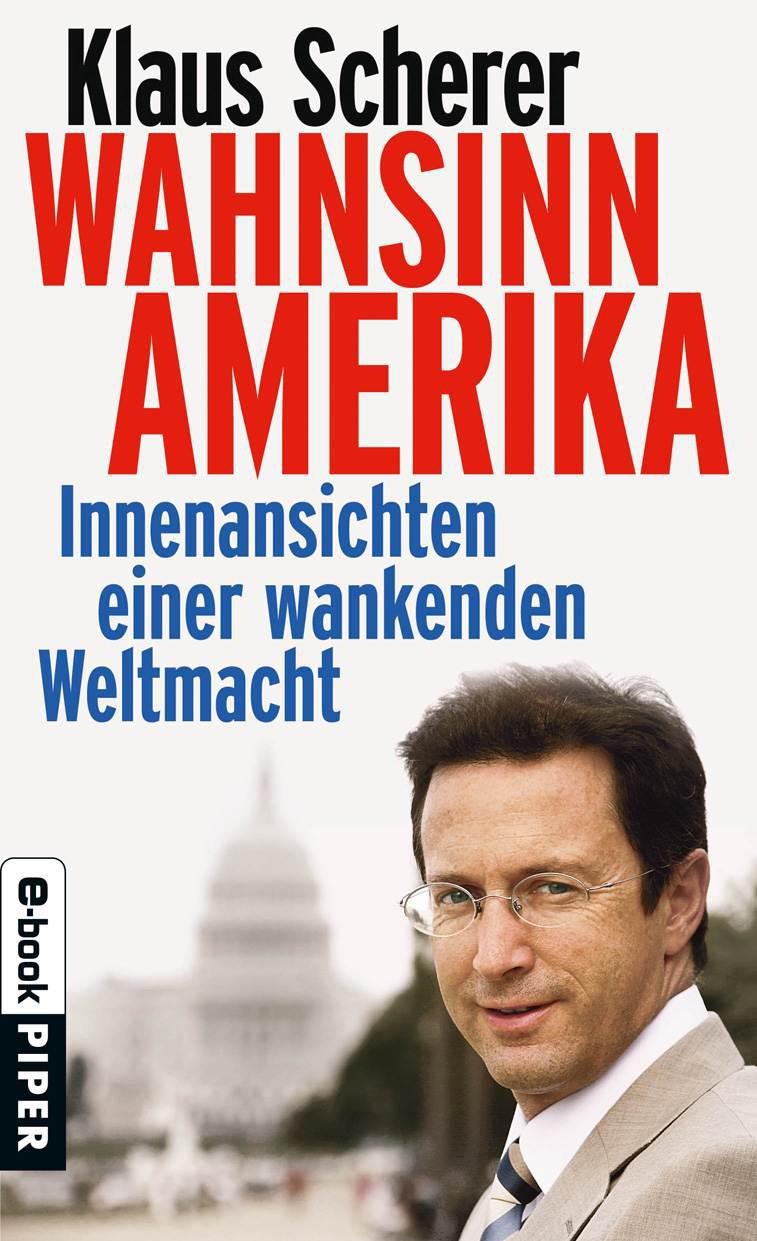![Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)]()
Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)
gerade einer Gesundheitsreform, das die politische Rechte nach ihrer Niederlage wie ein Geschenk zu nutzen wusste, statt dem verhassten Sieger die Führungsrolle zuzubilligen.
Seither steht Obama ebenso im Gegenwind wie zuvor die Clintons und kann nur noch zwischen düsteren Alternativen wählen. Drückt er die Reform gegen die Republikaner durch, trifft ihn der Vorwurf, er halte sein Versprechen nicht, ein versöhnender, ausgleichender Präsident zu sein. Gibt dagegen auch er die Gesundheitsreform auf, opfert er schon im ersten Jahr trotz klarem Wählerauftrag sein wichtigstes Projekt. Beides würde seinem Ansehen schaden, denn der Erfolgsdruck, der auf Obama seit dem Wahlsieg lastet, ist gewaltig. Erstmals sehen seine Gegner im US-Kongress den Präsidenten politisch in der Falle. Von nun an müssen sie ihm nur noch die Auswege verbauen.
Der Präsident entscheidet sich für die Reform – und beschließt, auch seinerseits den Dauerwahlkampf fortzusetzen. Vom Spätsommer an krempelt er wieder die Manschetten hoch und wirbt für seinen Plan. Und für die eigene Mehrheit.
»Es geht um hart arbeitende Amerikaner, die zu Geiseln ihrer Krankenversicherer geworden sind«, schaltet er auf die alte Vorwahlrhetorik zurück. »Die verweigern ihnen den sicher geglaubten Schutz oder erhöhen die Kosten, bis die Kranken ihn sich nicht mehr leisten können. Dieses System ruiniert Firmen und Familien. Und deshalb werden wir es reformieren.«
Auch Pointen setzt er, wie in den Hochphasen der Wahlkampagne: »Es gibt Fälle, in denen der Versicherungsschutz angeblich keine inneren Organe abdeckt, weil ein Patient als Kind einmal einen Unfall hatte. Bedenken Sie, wie viele Organe der Mensch hat. Vermutlich ist da nur noch unsere Haut versichert«, witzelt er, während die Zuhörer erheitert Beifall klatschen.
Auch er selbst stellt sich in Fragerunden nun den Gegenargumenten. »Wie sollen Versicherungen überleben, wenn ihnen der Staat Konkurrenz macht, der gar keine Profite erwirtschaften muss?«, fragt ihn jemand.
»Das funktioniert«, antwortet Obama. »Nehmen Sie private Zustelldienste. Die behaupten sich auch gegen die Post. Und warum? Weil sie einfach etwas besser sind. Das könnten dann auch Privatversicherungen.«
In Umfragen bleiben die Amerikaner dennoch skeptisch. Die Mehrheit findet weiter, Obama packe das Problem falsch an. Viele fürchten, das Gesetz würde zu teuer. Dennoch gibt der Präsident nicht auf. Lieber verzichte er auf eine zweite Amtszeit, legt er sich fest, als auf seine wichtigste Reform.
Ende August 2009 verlieren die Demokraten einen, der hätte vermitteln können: Senator »Ted« Kennedy. Mehr als jeder andere war er bis zu seiner Krebserkrankung die graue Eminenz der Washingtoner Politik. Nachrufe würdigen ihn als »liberalen Löwen«, der fest in der US-Linken verwurzelt war, und eben deshalb jederzeit zu den Konservativen hinübergehen und sie fragen konnte: »Was wollt ihr, damit wir uns einigen?« Stimmte er einem Deal zu, konnten andere Linke es erst recht tun. Kennedy genoss Respekt, denn er hatte alles erlebt und nichts mehr zu verlieren. Auch er hatte eine interne Kandidatur als Präsident verloren, war am Boden und hatte sich neu erfinden müssen. Er starb als einer der einflussreichsten Senatoren, die Amerika je hatte. Vor Fahnen, die auf Halbmast wehen, berichte ich am Todestag: »Gerade im Lagerstreit um Obamas nationale Gesundheitsreform, die auch Ted Kennedys politisches Lebensziel war, könnte er bald bitter fehlen.« Ich glaube bis heute, dass es stimmte.
In seiner Autobiografie hatte Kennedy festgehalten, wie sehr ihn der Parteienstreit an frühere Grabenkriege erinnerte. Noch in den Siebzigerjahren war er in Boston beschimpft und mit Steinen beworfen worden, weil Rassisten noch immer nicht zulassen wollten, dass weiße und schwarze Kinder gemeinsam in Schulbussen fuhren. Hasserfüllte Bürger hinderten ihn am Reden. Auf Kundgebungen mussten ihn Polizisten schützen.
Je öfter ich den Unmut, der Obama seit seiner Wahl entgegenschlägt, zu erklären oder zu bewerten habe, desto mehr frage ich mich, welche Vergleiche eigentlich angemessener sind. Solche mit der traditionell breiter ausgerichteten Sozialpolitik der Deutschen? Oder doch eher mit jenem Amerika vor gar nicht allzu langer Zeit, das seine fortschrittlichsten Präsidenten, Kandidaten und Bürgerrechtler einfach niederschoss? Ebenso, wie man von Obama enttäuscht sein könne, notiere ich einmal, könne man auch von den
Weitere Kostenlose Bücher