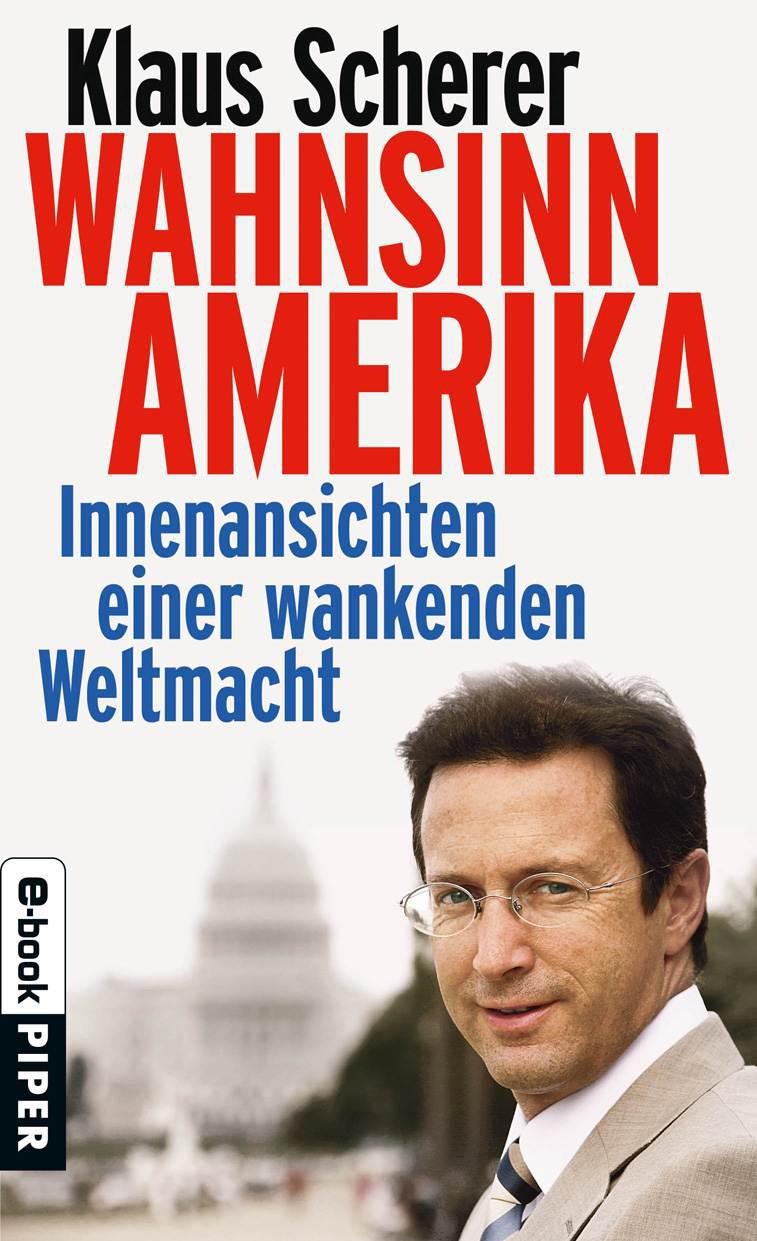![Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)]()
Wahnsinn Amerika: Innenansichten einer Weltmacht (German Edition)
»aber es scheint fast so zu sein, dass man sich bei uns ins Präsidentenamt einkaufen muss. Das steht so nicht in der Verfassung.« Der Verkäufer sieht das ähnlich. »Es stimmt«, sagt er, »die Art, wie wir inzwischen Wahlkampf machen, ist ziemlich kaputt.«
Die sogenannten Super-PACs, die als angeblich neutrale »politische Aktionskomitees« im Auftrag ihrer Kandidaten die Großspender-Millionen sammeln, um sie in Fernsehclips zu gießen, dominieren da längst den Wahlkampf. »Wir haben die gesamte Debatte verändert«, freut sich ein Helfer Gingrichs in der Washington Post . »Unsere Spots sind dicht gebucht. Verdrängt werden sie nur noch von uns selbst, sobald wir neue vorlegen.«
Wochen später vollzieht freilich auch Obama eine glatte Wende. Obwohl einer der heftigsten Kritiker sowohl des Gerichtsurteils als auch eines vom Großkapital finanzierten Superwahlkampfs, lässt er ebenfalls ein Super-PAC einrichten, das Großspenden einsammeln soll. Die Situation sei leider nicht so, erklärt sein Kampagnensprecher, dass das Präsidentenlager »einseitig abrüsten« könne.
Blutige Schlachten, langer Krieg ?
Dass sich die konservativen Herausforderer derart beschädigen wie zuletzt, versucht die Partei eigentlich durch ihr sogenanntes elftes Gebot zu unterbinden. Demnach dürfen Attacken allein auf den gemeinsamen Gegner zielen. Nur darin sollten sie sich überbieten. Auch geben fast alle Amerikaner in Umfragen an, dass sie Negativ-Kampagnen ablehnen. »Das ist ein wenig paradox«, findet Experte Ford O’Connell, »denn zugleich glauben sie erstaunlich viel davon.«
Anders als John McCain, der seinen Wahlkampf gegen Obama mit einigem moralischen Augenmaß anführte, ist Newt Gingrich nicht eben für Beißhemmungen bekannt. Schon als er im Kongress fast blindwütig gegen den damaligen Präsidenten Bill Clinton zu Felde zog, wandte sich seine Partei am Ende gegen ihn, weil ihr der Flurschaden zu groß wurde. Nicht nur, dass seine Haushaltsblockade politisch eher der eigenen Partei schadete. Ausgerechnet Gingrich, der das Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton wegen dessen Sexaffäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky vorangetrieben hatte, musste später zudem einräumen, dass er zeitgleich selbst eine Geliebte hatte. Am Ende verlor er sein Amt als Chef des Repräsentantenhauses und wurde wegen Verstößen gegen die Parlamentsethik ermahnt. Danach diente er sich ausgerechnet dem halbstaatlichen Immobilienfinanzierer Freddie Mac an, den die Konservativen regelmäßig als Korruptionsgeflecht der Demokraten orten, und kassierte Beraterhonorare in Millionenhöhe.
All das bündeln Gingrichs Gegner, um wiederum auf ihn zu feuern. In TV-Spots steht er von Koffern überhäuft vor einem Gepäckband. »Der Mann«, heißt es dazu süffisant, »schleppt mehr Ballast mit sich als jede Fluglinie.«
Dennoch katapultiert sich Gingrich mit seinem geschickten Debattensolo in South Carolina zu seinem ersten Vorwahlsieg. Schon in der Siegerrede probt er danach den nächsten Schritt: Er gibt sich präsidial. Plötzlich lobt er die Kontrahenten als ehrenwerte Mitstreiter, die bei allen Unterschieden nur die Großartigkeit der Republikanischen Partei bewiesen. Fast väterlich preist er Romney als tüchtigen Patrioten. Die Botschaft ist klar: Jetzt sollen sich die anderen hinter ihm einreihen, um gemeinsam mit der rechten Basis die wahren Feinde ins Visier zu nehmen – Obama, Europa und den Sozialismus.
»Dies wird die wichtigste Wahl unseres Lebens«, gibt er als Parole aus, »entweder wir bleiben ein freies Land, oder wir werden zu einem säkularen, bürokratischen, sozialistischen System europäischen Stils.« Wenn Obama schon jetzt so weit gekommen sei, könne sich jeder Amerikaner selbst ausmalen, »wie radikal er erst in einer zweiten Amtszeit würde«.
Auf den gedemütigten Romney, der auf der konservativen Anti-Europa-Welle selbst hatte surfen wollen, warten derweil Hausaufgaben. Denn auch ihn hat ABC durch eine Exklusivstory unter Druck gesetzt. Darin zeichnet der Reporter die »Spur von Romneys Reichtum«, wie er sagt, bis ins Steuerparadies der karibischen Cayman-Inseln nach, wo sich Briefkastenfirmen wie die von Romney üblicherweise nur ansiedeln, um dem heimischen Fiskus zu entgehen. Zudem muss Romney öffentlich einräumen, dass er auch im Inland nur einen Ministeuersatz von etwa 15 Prozent abführe. Da seine Steuererklärung aber nur unfaire Attacken der Demokraten auslösen würde, kokettiert er, wolle er
Weitere Kostenlose Bücher