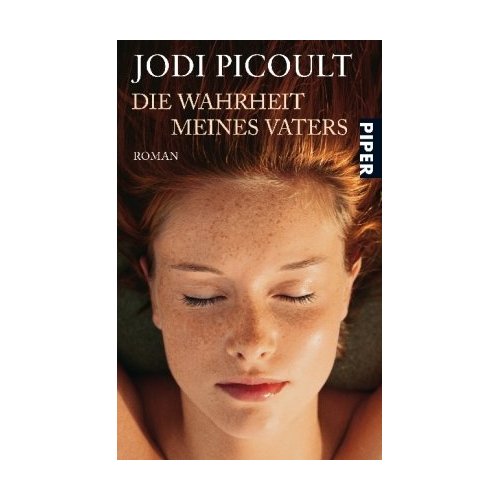![Wahrheit Meines Vaters, Die: Roman]()
Wahrheit Meines Vaters, Die: Roman
Das habe ich nicht verdient.«
Eric wirbelt so schnell herum, daß meine Mutter auf ihrem Stuhl zurückschreckt. »Und Ihre Tochter?
Womit hat sie es verdient, von der Schule nach Hause zu kommen und sich fragen zu müssen, was sie erwartet, wenn sie das Haus betritt?« fragt er. »Welches Kind hat es verdient, die Einladungen zu einer Feier im Kindergarten oder in der Schule verstecken zu müssen, damit die eigene Mutter bloß nicht auftaucht, betrunken, weil das einfach zu peinlich wäre? Oder der einzige in der dritten Klasse zu sein, der seine Wäsche selbst waschen und sich selbst etwas zu essen kaufen muß, weil es sonst keiner für mich gemacht hat?«
Im Saal wird es so still, daß es wirkt, als hätten die Wände einen eigenen Herzschlag. Richter Noble runzelt die Stirn. »Mr. Talcott?«
»Ich meine, für sie , für das Kind«, berichtigt Eric mit hochrotem Gesicht. Er läßt sich in seinen Sessel sinken. »Keine weiteren Fragen.«
»Mir geht's gut«, versichert Eric mir Minuten später in einer Sitzungspause. »Ich habe nur eine Sekunde lang vergessen, wo ich bin.« In dem Besprechungsraum, wohin wir uns zurückgezogen haben, hebt er einen Sty-roporbecher mit noch immer zitternder Hand. Etwas Wasser tropft ihm auf Hemd und Krawatte. »Könnte uns sogar ein paar Pluspunkte eingebracht haben.«
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dazu bin ich selbst viel zu erschüttert. Ich wußte zwar, daß die Zeugenaussagen hart werden könnten, aber ich war nicht darauf vorbereitet, was für Erinnerungen sie bei mir heraufbeschwören würden.
»Ich hol dir ein Papierhandtuch«, bringe ich mit Mühe heraus und verschwinde auf die Damentoilette.
Als ich vor dem Spiegel stehe, breche ich in Tränen aus.
Ich beuge mich vor und spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht, bis der Kragen meiner Bluse ganz naß ist.
Hier«, sagt eine Stimme, und eine Hand reicht mir ein Papierhandtuch.
Als ich aufblicke, steht meine Mutter neben mir.
»Es tut mir leid, daß du dir das anhören mußtest«, sagt sie leise. »Es tut mir leid, daß ich es sagen mußte.«
Ich drücke mir das Handtuch ans Gesicht, damit sie nicht sieht, daß ich weine. Sie kramt in ihrer Handtasche und öffnet dann ein Pillendöschen aus Keramik. »Nimm das. Das hilft.«
Ich starre argwöhnisch auf die Tablette in meiner Hand.
»Das ist Tylenol«, sagt sie trocken.
Ich schlucke sie und wische mir mit dem Handrücken über den Mund. »Wo bist du damals hin?« frage ich.
Sie schüttelt den Kopf. »Wann?«
»Du hast uns einmal verlassen. Du warst weg, etwa eine Woche lang.«
Meine Mutter lehnt sich gegen die Wand. »Du warst so klein. Unglaublich, daß du dich überhaupt daran erinnern kannst.«
»Ja«, sage ich. »Stell dir vor. Warst du weg, um dich zu betrinken? Oder um trocken zu werden?«
Sie seufzt. »Dein Vater hatte mir ein Ultimatum gestellt.«
Keiner sagte mir, wohin sie gefahren war. Ich fragte mich, ob ich nicht lieb gewesen war, ob sie deshalb gegangen war. Ich benahm mich daraufhin die ganze Woche besonders brav: räumte nach dem Spielen meine Spielsachen weg, guckte nach rechts und links, bevor ich die Straße überquerte, putzte mir morgens und abends minutenlang die Zähne.
Ich fragte mich, ob sie wiederkommt.
Ich fragte mich, ob ich wollte, daß sie wiederkommt.
Ich sagte meinem Vater nichts von alldem, hielt meine Angst vor ihm verborgen wie er seine vor mir.
»Hat es funktioniert?« frage ich.
»Eine Weile. Und dann ... wie alles andere ... nicht mehr.« Meine Mutter blickt mich an. »Dein Vater und ich hätten nie heiraten sollen, Delia. Es ging alles sehr schnell - wir kannten uns kaum, und dann wurde ich schwanger.«
Ich schlucke schwer. »Hast du ihn denn nicht geliebt?«
Sie reibt über einen unsichtbaren Fleck am Waschbeckenrand. »Es gibt zwei Arten von Liebe, mija. Bei der sicheren Variante suchst du dir jemanden, der genauso ist wie du. Dafür entscheiden sich die meisten. Aber dann gibt es noch die andere Art.«
Sie holt tief Luft. »Ich hatte die High-School abgebrochen und arbeitete in einer Bikerbar. Als ich deinen Vater kennenlernte, hatte er sein Leben bereits durchgeplant, so einer war er. Er dachte ernsthaft, ich wäre fähig, Mutter zu sein, mich um eine Familie zu kümmern - und ich, ja, ich wollte ihm das so gern glauben. Ich wollte der Mensch sein, den er sah, wenn er mich anblickte ... es war so viel mehr, als ich je von mir selbst gedacht hatte.« Sie lächelt schwach. »Wie du«, sagt meine Mutter.
Weitere Kostenlose Bücher