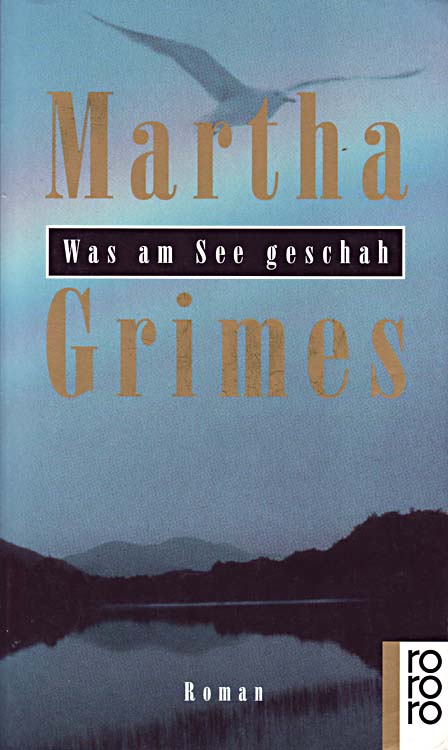![Was am See geschah]()
Was am See geschah
Lichtstreifen. Er kroch dann immer aus dem Bett und legte sich mit dem Gesicht zur Tür und sah nichts als diesen Lichtstreifen, seine Mutter sah er nicht. Er dachte, sie sei für immer fortgegangen. Er lag dann dort und wünschte sie zurück, bildete sich ein, durch die schiere Kraft seines Willens, durch seine Konzentration könne er sie dazu bringen, in sein Zimmer zurückzukehren; er glaubte zu hören, daß das verschwommene und ferne Klappern ihrer Pantoffeln im Gang deutlicher wurde, wieder näher kam und vor seiner Tür innehielt. Doch sein Wille war wohl nicht stark genug, es mußte da irgendeine Schwäche bei ihm geben, denn sie kehrte nicht zurück.
Er lag dann auf der Seite und starrte auf das Lichtband unter der Tür. Wenn er nicht hinschaute, würde ihn die Dunkelheit verschlingen. Denn wenn sich seine Augen auch an die Finsternis gewöhnten, so würden die Dinge in seinem Zimmer - der klobige Sessel, der Schreibtisch, die Höcker zwischen den Bettpfosten, die Pfosten selber - nicht mehr zu unterscheiden sein, verlören ihre klaren Umrisse und tauchten wieder ein in die Dunkelheit, schon allein durch seinen starren Blick, der sie doch dem Dunkel entreißen sollte. Sein bester Freund aus der damaligen Zeit hatte entsetzliche Angst vor dem ›Ding‹ gehabt, das nachts in seinem Schrank hockte, ein Monster mit Zähnen wie Glasscherben, und er konnte spüren, wie die Zähne zersplitterten, wenn ihm das Ungeheuer in die Kehle biß.
Doch er, er hatte sich nie vor einem ›Ding‹ im Schrank gefürchtet; er hatte vor dem Schrank selber Angst gehabt, vor der Dunkelheit und der Einsamkeit. Denn die kamen immer zu zweit. Am Tag war die Einsamkeit lange nicht so schlimm, denn er war draußen und machte etwas. Er empfand sie jedoch immer, auch tagsüber, als einen stumpfen Schmerz; denn selbst wenn er mit anderen Menschen zusammen war, so spürte er in ihrer Gegenwart doch nie, was er brauchte. Er brauchte Nähe.
Die brauchte natürlich jeder; er unterschied sich nicht von anderen Menschen, nur war sein Bedürfnis ein verzehrendes. Die Einsamkeit trieb ihn zur Verzweiflung. Er fragte sich, warum die Ärzte die Nähe ausgelassen hatten auf ihrer Liste: Sex, Hunger, Durst. Würde er für ein Glas Wasser, eine Dose Bohnen oder einen guten Fick jemanden umbringen? Sex? Aber Sex hatte doch kaum etwas damit zu tun.
Seine Hände berührten die Seitenwände der Schublade; er konnte in den Speiseschrank gucken, sah die leckende Wasserleitung, aus der es tröpfelte (er mußte die Waschmaschine mal reparieren), und dachte sich ganz vernünftig, da er ja nie am Verhungern oder Verdursten gewesen war, könne er auch nicht wissen, wozu ein Mensch in einer solchen Lage fähig war. Und was den Sex betraf, so nahm er an, daß es nicht wörtlich gemeint war, wenn es hieß, man würde für einen Fick töten. Er runzelte die Stirn. Aber töteten Tiere denn nicht...?
Er blickte auf die Messer hinunter, die das Licht der grellen Birne reflektierten, schüttelte den Kopf und versuchte, Klarheit zu gewinnen. In seinem Kinderzimmer war ein solches Licht gewesen, es schaukelte leise über seinem Bett, bis seine Mutter an der Kette zog. Manchmal legte sie sich zu ihm ins Bett, und nicht einmal ihr schwerer Whisky- und Zigarettenatem machte ihm etwas aus. Nein, es machte ihm nichts aus.
Weiß Gott, er hatte andere Methoden ausprobiert, um sich zu holen, was er brauchte. Um die Einsamkeit loszuwerden und Nähe zu finden. Sogar das Wort klang warm und geschmeidig. Wenn seine Sprache nur nicht so konfus gewesen wäre, diese dummen Wörter, die sich gegenseitig anstießen, aufeinanderkrachten, einander zerfleischten bei ihrer Jagd nach Freundschaft und Nähe; und wenn die Frauen nicht zu Boden geschaut hätten, weggeschaut hätten und sogar zurückgewichen wären, fast als (nun mußte das Gesicht, das sich wieder über die Schublade beugte, unwillkürlich lächeln)...
Als bedrohe er sie mit einem Messer.
Er haßte es, daß er ihnen das Messer zeigen mußte und sie erfahren mußten, daß sie sterben würden. Denn wenn dies das Ende auch nicht völlig verdarb, so wurde es dadurch doch traurig und sehr viel schwieriger. Aber es gab keine andere Möglichkeit, denn sie mußten erkennen, was sie getan hatten und worin ihre Schuld bestand. Wie seltsam war doch jene weitverbreitete Ansicht, der Ausdruck in den Augen eines Sterbenden, unmittelbar vor dem Augenblick des Todes, im Moment des Sterbens selbst, sei distanziert, verschleiert, verhangen.
Weitere Kostenlose Bücher