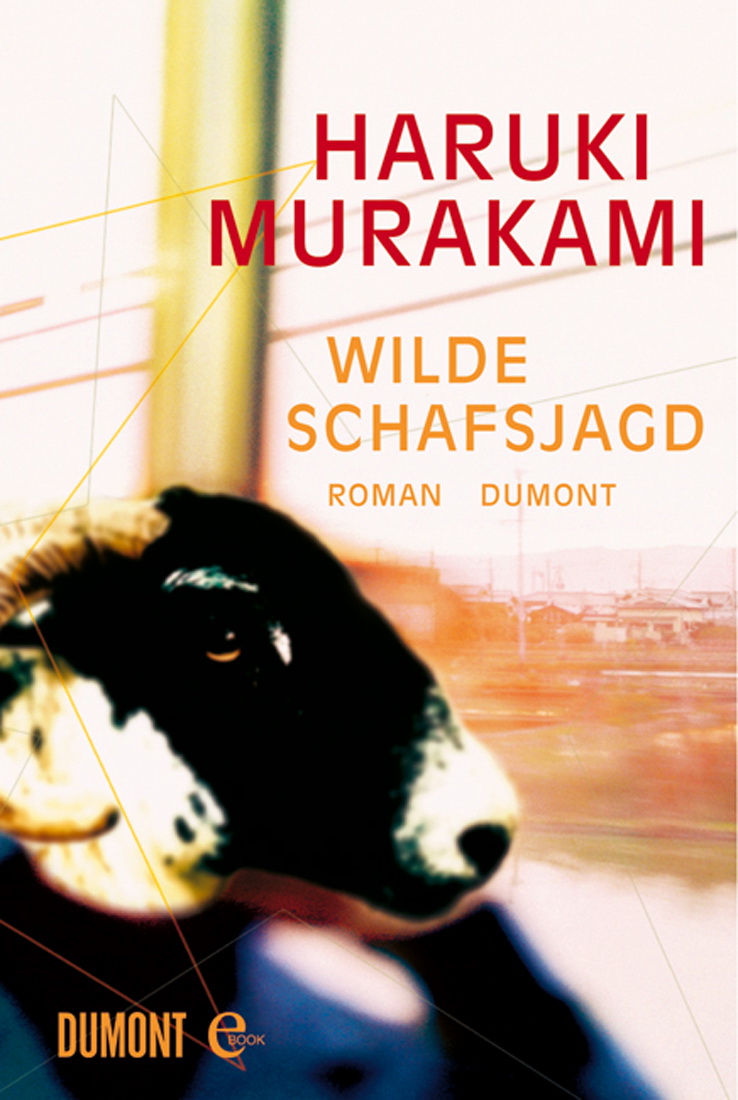![Wilde Schafsjagd]()
Wilde Schafsjagd
dann nach rechts und ungefähr noch dreihundert Meter geradeaus. Es war ein gutes altes Gasthaus, die Fassade stammte aus den Tagen, da noch Lebensgeister in der Stadt gesteckt hatten. Zum Fluss hin gab es einen sorgsam gepflegten Garten. In einer Ecke nahm ein Schäferhundwelpe ein frühes Abendessen ein; sein Kopf verschwand fast im Fressnapf.
»Sind Sie zum Bergsteigen hier?«, fragte uns das Dienstmädchen, das uns das Zimmer zeigte.
»Ja«, antwortete ich der Einfachheit halber.
Im ersten Stock gab es lediglich zwei Zimmer, die dafür aber sehr geräumig waren. Vom Flur aus blickte man auf denselben Milchkaffeefluss, den ich schon vom Zugfenster aus gesehen hatte.
Meine Freundin wollte ein Bad nehmen, und deshalb ging ich in der Zwischenzeit alleine zur Stadtverwaltung. Sie befand sich zwei Blocks westlich von der Einkaufsstraße in einer vollkommen verlassenen Gegend, doch der erste Eindruck täuschte: Das Gebäude war relativ neu und stabil.
Am Schalter des Amtes für Viehzucht zeigte ich eine mit dem Namen einer Zeitschrift versehene Visitenkarte vor, die ich vor knapp zwei Jahren einmal benutzt hatte, um mich als freier Journalist auszugeben, und erklärte kurz, ich wolle ein paar Fragen über Schafzucht stellen. Eigentlich eine unglaubwürdige Geschichte, für eine Frauenzeitschrift über Schafe zu recherchieren, aber der Beamte schluckte sie ohne weiteres und führte mich in sein Büro.
»Zurzeit gibt es zirka zweihundert Schafe in der Stadt, alles Suffolks. Das heißt, Fleischtiere. Das Fleisch wird an die umliegenden Gasthäuser und Restaurants geliefert. Es ist sehr beliebt.«
Ich zog meinen Notizblock aus der Tasche und schrieb in angemessener Weise mit. Der arme Mann würde höchstwahrscheinlich monatelang jede Nummer dieser Frauenzeitschrift kaufen. Ich schämte mich.
»Für die Rezeptseite?«, fragte er mich, nachdem er eine Weile über die Situation der Schafzucht berichtet hatte.
»Auch«, sagte ich. »Aber wir wollen eher ein Gesamtbild des Schafs zeichnen.«
»Gesamtbild?«
»Ja, seine Charakteristika, seine Lebensbedingungen, alles.«
»Oh«, sagte mein Gesprächspartner.
Ich klappte mein Notizbuch zu und trank den Tee, den man mir serviert hatte. »Ich habe gehört, oben in den Bergen soll es noch eine alte Schafweide geben?«
»Ja, bis vor dem Krieg war es eine richtige Weide, aber nach dem Krieg wurde sie von der amerikanischen Armee beschlagnahmt. Nach der Rückgabe an den Besitzer wurde das dazugehörige Haus zehn Jahre lang von irgendeinem wohlhabenden Herrn als Landhaus genutzt, aber jetzt kommt schon lange niemand mehr, offensichtlich wegen der äußerst schlechten Verkehrsbedingungen. Es steht leer. Deshalb wurde die Weide an die Stadt verpachtet. Das Beste wäre, man würde alles kaufen und eine Touristenattraktion draus machen, aber wir sind ein armes Städtchen, wissen Sie. Die Straßenausbesserungen haben Vorrang.«
»Die Weide wird an die Stadt verpachtet?«
»Ja, im Sommer werden ungefähr fünfzig Schafe der Städtischen Schäferei auf den Berg getrieben. Die Weide dort oben ist ausgezeichnet, und auf der städtischen reicht das Gras nicht. Wenn das Wetter dann langsam schlechter wird, so etwa ab Ende September, bringt man sie wieder herunter.«
»Wissen Sie, von wann bis wann die Schafe oben sind?«
»Das ist von Jahr zu Jahr verschieden, meistens aber von Anfang Mai bis Mitte September.«
»Wie viele Leute bringen die Schafe auf die Bergweide und versorgen sie dort?«
»Nur einer. Seit zehn Jahren schon macht das derselbe Mann.«
»Ich würde ihn gerne einmal sprechen.«
Der Beamte rief für mich bei der Städtischen Schäferei an.
»Wenn Sie jetzt gleich hinfahren, können Sie ihn treffen«, sagte er. »Soll ich Sie mit dem Wagen hinbringen?«
Zuerst lehnte ich ab, begriff aber bald, dass dies die einzige Möglichkeit war, die Weide zu erreichen. In der Stadt gab es weder ein Taxi noch einen Autoverleih, und zu Fuß brauchte man anderthalb Stunden.
In dem Kleinwagen des Beamten fuhren wir an dem Gasthaus vorbei Richtung Westen. Dann überquerten wir eine lange Betonbrücke, die uns über ein kaltes Sumpfgebiet führte, und nahmen einen sanft ansteigenden Weg den Berg hinauf. Unter den Rädern knirschte trocken der Kies.
»Wenn man in Tokyo wohnt, kommt einem dieses Städtchen wahrscheinlich wie ausgestorben vor, nicht wahr?«, sagte er.
Ich gab eine unverbindliche Antwort.
»Na ja, aber es stirbt wirklich langsam aus. Solange es die Eisenbahn
Weitere Kostenlose Bücher