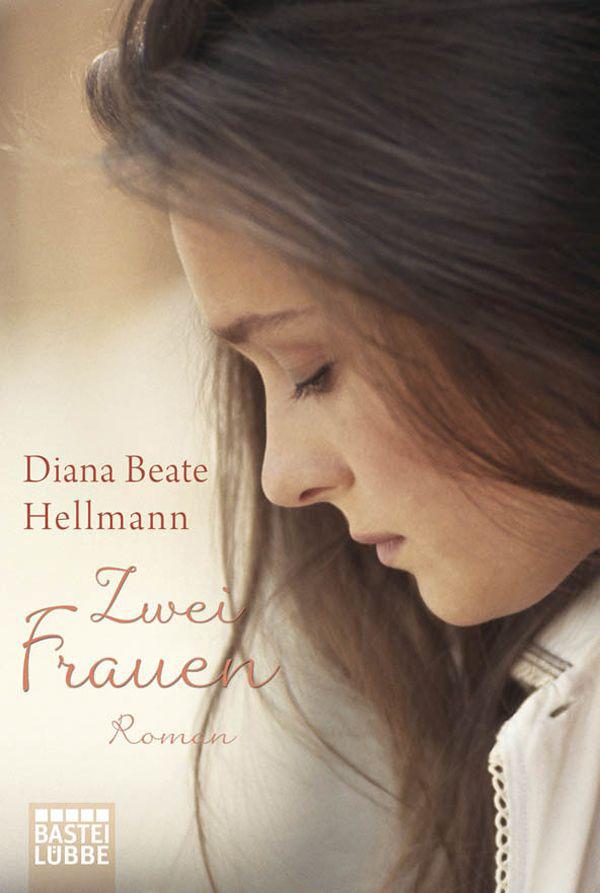![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
eine Nutte, Eva. Die würde auch radioaktiv verseuchten Schmuck tragen, wenn er nur schön wäre. Na, und diese Frau Gruber …!«
Mir war bekannt, was meine Großmutter von der hielt. Schon vor Jahren hatte sie behauptet, diese Frau hätte gewisse Eigenschaften mit einem gewissen Schweinehirten aus einer gewissen Operette gemein: »Ja, das Schreiben und Lesen sind noch nie mein Fall gewesen …« Daher hatte Oma auch nie geglaubt, dass meine Ballettmeisterin jenen Brief, über den ich damals so unglücklich gewesen war, im Alleingang verfasst hatte. Dazu reichten ihres Erachtens weder Frau Grubers Orthografie- noch ihre Grammatikkenntnisse aus.
»Wie willst du von so einem Menschen erwarten, dass er eine derart subtile Rache versteht? – Eva, ich würde mir das noch einmal überlegen!«
Oma gab sich alle erdenkliche Mühe, konnte mich aber nicht umstimmen. Nachdem mehrmals das übliche »Wie bitte?«, erklungen war und ich ebenso oft erklärt hatte, dass es hier doch schließlich um meinen letzten Willen ginge, gab sie sich geschlagen.
»Also gut«, seufzte sie, »du musst es wissen, und ich habe keine Lust, noch länger auf diesem harten Schemel zu sitzen!«
Damit war alles geregelt. Meine Großmutter ging. Sie ging, ohne sich in besonderer Weise von mir zu verabschieden, ohne mir Glück zu wünschen.
»Es ist unnötig, das Leben zu dramatisieren, Eva …! Es ist dramatisch!«
Wie Recht sie damit hatte, wurde mir bald klar. Meine Ruhe und meine Gelassenheit schwanden mit jedem Augenblick, den die Operation näher rückte, und als die letzten vierundzwanzig Stunden anbrachen, begann auch für mich eine Nervenprobe ohnegleichen. Bis dahin hatte ich mich stark und ausgeglichen gefühlt. Jetzt fühlte ich mich plötzlich nur noch hilflos. Ich wollte nicht nachdenken und musste doch an so vieles denken, und damit kam die Angst. Es gab nun kein Zurück mehr, und das quälte mich, obwohl ich eigentlich gar nicht zurück wollte. Es war wie damals vor meiner letzten Chemotherapie. Wieder fieberte ich einem Ereignis entgegen wie meinem Hinrichtungstermin, wieder wollte ich das Unvermeidbare hinter mich bringen und war doch zugleich von grenzenloser Furcht vor diesem Unvermeidbaren erfüllt. »Wat en Theater!«, hatte Claudia damals dazu gesagt. Jetzt musste ich mir das selbst sagen, und da klang es weit weniger überzeugend. Ich war einsam, kraftlos, mir selbst überlassen, ich hatte Angst vor meiner eigenen Schwäche und wusste nicht, wie ich sie besiegen sollte.
Dieser Zustand erreichte am Nachmittag des 9. Januar seinen Höhepunkt. Meine Eltern saßen an meinem Bett und suchten vergeblich nach einem unverfänglichen Gesprächsthema, denn jedes Wort schien auf die bevorstehende Operation abzuzielen, und das brachte meine Mutter zum Weinen und meinen Vater zum Toben. Also übte man sich gezielt in der Kunst des Überspielens. Da jeder von uns bemüht war, zuversichtlich und entspannt zu wirken, verkrampften wir völlig. Jedes »Lächeln« wurde zu einer Grimasse, jeder »Scherz« zu bitterem Ernst, jedes »lockere« Seufzen zum Schmerzensschrei. Nach etwa einer Stunde war ich es leid.
»Ich kann nicht mehr!«, jammerte ich. »Ich kann das nicht aushalten, und deshalb ist es vermutlich das Beste …«
»Wenn wir gehen?«, flüsterte meine Mutter.
»… ja!«
»Gut, Kind … wenn du meinst!«
Zu meinem Erstaunen wirkten sie weder verärgert noch betrübt. Dankbar sah ich ihnen dabei zu, wie sie einander in die Mäntel halfen, wie mein Vater seinen Hut aufsetzte, wie meine Mutter ihre Handschuhe anzog … Noch nie zuvor hatte ich diese Gesten eines Aufbruchs mit ähnlicher Intensität beobachtet. Nichts entging mir, jede noch so winzige Bewegung, jeden noch so flüchtigen Blick nahm ich auf, … und ich wusste plötzlich, dass diese beiden Menschen, die ich Eltern nannte und über alles liebte, nur deshalb in dieser Stunde von mir gehen mussten, um mir endlich wirklich nahe zu sein. Ich brauchte sie jetzt in mir, nicht um mich her. Ich brauchte jetzt meine Freiheit, das Gefühl, auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen zu müssen.
»Ich liebe dich!«, sagte meine Mutter zum Abschied, und sie bemühte sich, dabei nicht zu weinen.
»Du schaffst das schon!«, sagte mein Vater, und er bemühte sich, es ganz besonders leise zu sagen. Ich sagte nichts, ich lächelte nur.
Da war er also nun, der vielleicht letzte Abend meines Lebens. Ich lag in einem frisch bezogenen Bett. Morgen Früh würde ich aufwachen,
Weitere Kostenlose Bücher