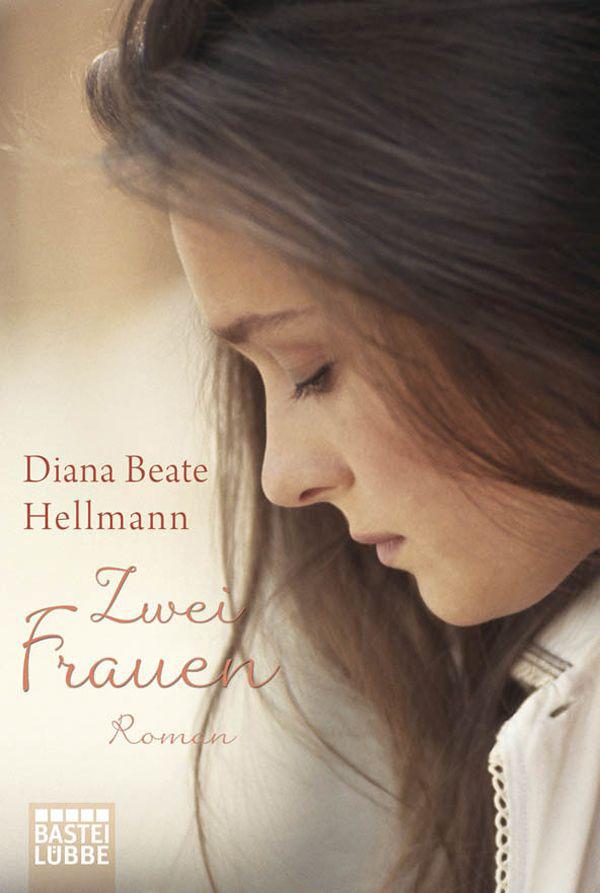![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
Leid, sondern auch sehr viel Schönes erlebt, als hätte ich unendlich viel gelernt, genug, um die Mauern niederzureißen, die mich noch von den anderen trennten.
Und das war meines Erachtens nur mehr eine Formsache! Den Mut dazu hatte ich schon seit langem, was mir noch fehlte, war lediglich ein wenig Kraft, jene Antriebskraft, die Daniela gerade in ihren Händen hielt.
»Wenn ich diese Klinik verlasse, möchte ich mein Leben in vollen Zügen genießen. Ich möchte einen Beruf ergreifen, der mir bedingungslos gefällt, sodass ich bereit bin, alles zu geben, was in mir steckt. Außerdem möchte ich reisen und fremde Länder sehen, nach New York fliegen und über die Fifth Avenue bummeln, in die Metropolitan Opera gehen, auf dem Empire State Building ein Eis lutschen … nach San Francisco möchte ich fahren und auf die Golden Gate Bridge hinabsehen, in eine Diskothek gehen und die ganze Nacht tanzen, Champagner trinken und erst beim Morgengrauen heimgehen … und in Acapulco möchte ich im warmen Sand liegen, die Brise des Pazifiks auf meiner Haut spüren, baden, den Felsenspringern zusehen, … und einen schwarzen Nerzmantel möchte ich mir kaufen, einen Pelz, der im Sonnenlicht bläulich schimmert und der so weit geschnitten ist, dass man nicht sehen kann, wie dünn ich bin. Fremde Menschen möchte ich kennen lernen, mit Männern schlafen und vielleicht auch mal mit einer Frau, ich möchte sexuell einfach alles kennen lernen, was es gibt und was schön ist. Vor allem aber möchte ich eines Tages dem Mann begegnen, an dessen Seite ich alt werden will. Ihn möchte ich lieben, und von ihm möchte ich geliebt werden, ihn möchte ich heiraten, und mit ihm möchte ich Kinder haben, am liebsten vier Söhne: einen Alexander, einen Maximilian, einen Konstantin und einen Dominik: In dieser Familie möchte ich die Liebe erleben, eine Liebe, die weder Gewohnheit noch Gleichgültigkeit ist, sondern ein allseitiges Geben und Nehmen, ohne Erwartungen und ohne banges Zittern vor dem Verlust.«
Daniela brauchte ziemlich lange, um diese beiden handgeschriebenen Seiten zu lesen. Als sie es endlich geschafft hatte, ließ sie die Papierbögen in ihren Schoß sinken, sah mich an und schwieg.
»Bist du erstaunt?«, fragte ich, als sie nach gut zehn Minuten immer noch schwieg.
Sie atmete schwer. »Nicht unbedingt«, sagte sie dann, »… wenn man dich so lange kennt wie ich …«
»Was dann?«
»Nun, Eva … weißt du, was Lebensgier ist?«
Die Frage kam mir äußerst bekannt vor, und sie signalisierte mir größtes Unheil. Deshalb setzte ich mich jetzt erst einmal hin.
»Hör mal!«, schimpfte ich dabei, »du hast mir extra gesagt, dass ich nicht bescheiden und realistisch sein müsste. Nutz das jetzt bitte nicht aus!«
»Keine Angst!«, erwiderte Daniela. »Das werde ich nicht tun. Ich nehme aber an, dass du für deine Verhältnisse bescheiden und realistisch gewesen bist. Oder?«
Ich überlegte nur kurz. »Das ist wahr«, gestand ich dann.
»Das dachte ich mir. – Also, Eva: Was ist Lebensgier?«
Ich stöhnte. »Das Benzin für ein Auto namens Todessehnsucht!«
Daniela schmunzelte. »Gut gelernt …«
»Nicht wahr?«
»… aber nicht verstanden!«
»Wieso?«
Sie sah mich an mit einem Blick, der mir mittlerweile vertraut war wie die eigene Haut. Er hatte etwas Sanftes und zugleich etwas Zynisches, und man tat gut daran, in Deckung zu gehen, wenn er aufblitzte, denn was dieser Blick ankündigte, führte der Mund in aller Regel im nächsten Moment aus. So war es auch in diesem Fall. Daniela fasste meinen zweiseitigen Aufsatz in einem einzigen Satz zusammen:
»Du möchtest in einem Traumberuf eine Traumkarriere machen, einen Traummann bekommen und traumhafte Kinder haben … und Geld und Gesundheit sollen fortan ebenso selbstverständlich sein, wie sie es vor deiner Krankheit waren, weil du sonst ja deine Traumreisen nicht machen und dir die winzigen Nebenträume nicht erfüllen könntest …«
»Na und?«, verteidigte ich mich, weil mir ja gar nichts anderes übrig blieb. »Ich finde eben, dass ich ein Recht auf all das hätte … nach zwei Jahren in diesem Loch!«
Dazu sagte sie nichts. Stattdessen holte sie tief Luft, legte meinen Aufsatz mitten auf den Schreibtisch, ihre Hände auf das Papier und starrte darauf. Das hielt ich für ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ich war sicher, dass diese Frau mich nur mal wieder auf Bescheidenheit hatte trimmen wollen, und dass sie nunmehr erkennen musste, dass ich viel zu stark
Weitere Kostenlose Bücher