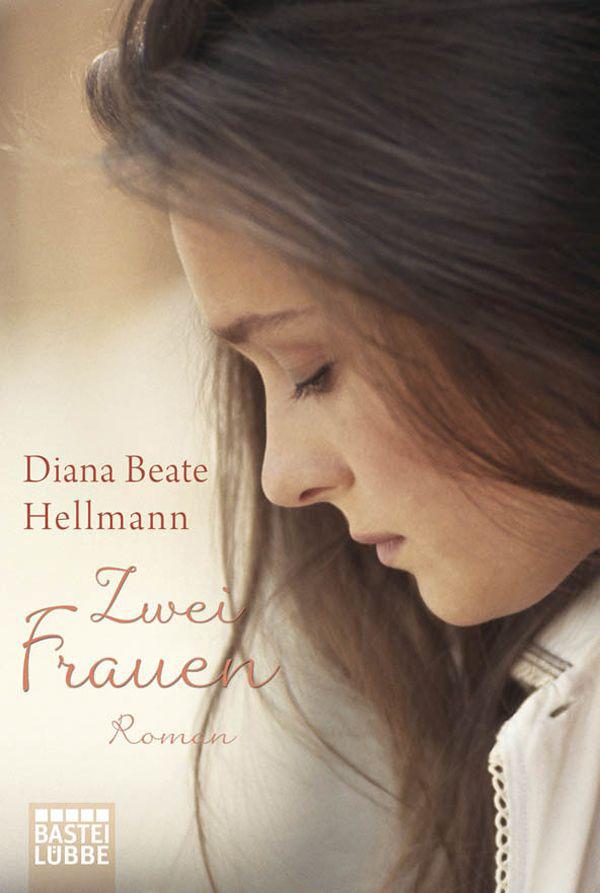![Zwei Frauen: Roman (German Edition)]()
Zwei Frauen: Roman (German Edition)
mich, erst einmal die Ruhe zu bewahren, wischte mir die Tränen ab, putzte mir die Nase.
Derweil saß Claudia auf ihrem Bett und ließ die Beine baumeln. So hatte sie zwar die ganze Zeit über dagesessen, doch fiel es mir jetzt erst auf. Als sie das bemerkte, lächelte sie mich an. »Siehse«, krächzte sie dann, »ich hab mir dat ja nie vorstelln können, dat du abkratzt. So wat wie du, dat beißt nu ma nich int Gras.«
Ihre Augen hatten einen merkwürdigen Glanz, während sie das sagte, und mir war auch, als würde ihre Stimme zittern.
»Hast du was?«, fragte ich sie deshalb.
»Nee! Ich hätt bloß auch gerne sonne Changse gekriecht, verstehse?«
Was für Claudia eine Chance zu sein schien, kam für mich einem Albtraum gleich, und als ich ihr das klar zu machen versuchte, kamen auch mir gleich wieder die Tränen.
»Ich weiß eben nicht mehr, was ich tun soll!«, schluchzte ich. »Was soll ich denn jetzt tun?«
»Leben!«, erwiderte Claudia, als verstünde sich das von selbst. »Wat denn sons?«
Fassungslos sah ich sie an. »Das will ich aber nicht. Das kann ich auch gar nicht!«
Sie winkte ab. »Nu hör aber auf, Evken, und geh ers ma bei deine Psycho-Tussi! Die wäscht dir dann schon den Kopp und rückt en dir zurecht.«
Da ich genau das Gleiche befürchtete, wollte ich ja gerade nicht zu Daniela gehen, nicht jetzt. Ich wollte mir erst einmal selbst alles durch den Kopf gehen lassen, in aller Ruhe und allein. Deshalb schloss ich mich, wie immer in solchen Fällen, im Badezimmer ein, setzte mich auf die Klobrille und begann zu überlegen.
Das war in meiner augenblicklichen Verfassung gar nicht so einfach. Die ganze letzte Zeit hatte ich nur deshalb überstanden, weil ich mich dem Tode so nah gefühlt hatte. Jetzt sollte ich plötzlich an das Leben denken, an die Zukunft, an Weihnachten im Kreise meiner Lieben, an zu Hause. Zu Hause! Das Wort klang in mir nach wie der Jubel eines Engelchores, und eh ich mich versah, tauchten traumschöne Bilder auf, Erinnerungen, die von der Sehnsucht rosarot gefärbt waren. Ich sah mein Elternhaus, den tief verschneiten Garten zur Winterzeit und das Wohnzimmer mit den gemütlichen Sesseln und dem knisternden Kamin. Ich sah Mama in ihrem dunkelblauen Abendkleid, und ich sah Papa, der eine seiner dicken Zigarren rauchte und mir zulächelte. Aus der Ferne hörte ich die Glocken der Lukaskirche, und der Christbaum mit den silbernen Kugeln und dem glitzernden Lametta strahlte nur für mich … für mich …
Es war wunderschön, sich das vorzustellen. Doch noch während ich mich in meinen Traum ergab, holte die Wirklichkeit mich ein: Ich bekam »die dicke Lippe«, jenes Phänomen, das mich Wochen zuvor auf der Intensivstation erstmals heimgesucht und seitdem nie wieder verlassen hatte. Es geschah plötzlich und unerwartet wie immer.
Als ich die stecknadelkopfgroße Verhärtung in der Mitte der Oberlippe spürte, befiel mich Panik. Ich sprang auf, starrte in den Spiegel und zitterte vom Scheitel bis zur Sohle. Aber noch war nichts zu sehen. Mein Mund sah aus, wie er immer aussah, mit seiner tiefen Venusfalte und der samtigen Haut. Ich wusste jedoch, wie bald sich das nun ändern würde, und weil ich es wusste, schwor ich mir, es mir dieses Mal in allen Phasen anzusehen, den Anblick zu ertragen.
Es war wie ein böser Traum. Mit jeder Sekunde schwoll der kleine Knoten an und dehnte sich aus, hatte bald schon die Größe eines halben Pfennigstücks erreicht, breitete sich aus auf die ganze Oberlippe, bis sie dreimal dicker war als zuvor. Nun war von meiner Venusfalte nichts mehr zu sehen. Was eben noch mein Mund gewesen war, war jetzt ein knochenharter, rosiger Wulst, der durch die Spannung glänzte wie ausgestülptes Plastik, das jeden Moment zu zerreißen droht.
Von grenzenlosem Abscheu erfüllt, starrte ich in den Spiegel. Ich sah tatsächlich aus wie ein aussätziger Gorilla. Die Leute auf der Intensivstation hatten das Kind schon beim rechten Namen genannt. Das hatte ich zwar immer geahnt, aber bisher hatte ich mir diesen Anblick stets erspart, war unter die Bettdecke geflohen, wenn das Drama begann, und erst dann wieder aufgetaucht, wenn es nach einigen Stunden wieder vorüber war.
Dass diese Vogel-Strauß-Politik ein Fehler gewesen war, wurde mir jetzt klar. Längst hätte ich der Wahrheit ins Auge blicken müssen, einer Wahrheit, die in meinem Gesicht geschrieben stand. »Sieh dich an!«, war da zu lesen. »Das bist du! Eine Beleidigung für die göttliche Schöpfung
Weitere Kostenlose Bücher