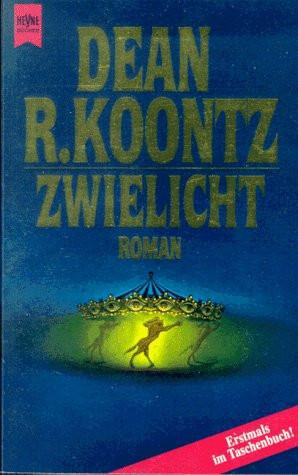![Zwielicht]()
Zwielicht
die Kerzen und die Streichhölzer in einer der Innentaschen meiner Jacke ein, und ich holte sie mit zittrigen Fingern hervor.
Die flackernde Kerzenflamme vertrieb die Dunkelheit ein wenig, allerdings nicht genug, als daß ich Rya hätte gründlich untersuchen können. Mit Hilfe der Kerze fand ich jedoch beide Taschenlampen und setzte neue Batterien ein.
Nachdem ich die Kerze ausgeblasen und wieder in der Tasche verstaut hatte, kniete ich neben Rya nieder. Die Taschenlampen legte ich so auf den Boden, daß sie angestrahlt wurde.
»Rya?«
Keine Antwort.
»Rya, bitte!«
Sie lag regungslos da.
Sie war sehr blaß.
Ihr Gesicht fühlte sich kalt an. Viel zu kalt.
Ich entdeckte eine Prellung, die sich gerade zu verfärben begann und von der rechten Stirnhälfte über die Schläfe bis zum Backenknochen verlief. In einem Mundwinkel schimmerte Blut.
Weinend hob ich ein Augenlid an, hatte aber keine Ahnung, was ich daran zu erkennen hoffte. Ich hielt eine Hand vor ihre Nase, um ihren Atem zu spüren, aber meine Hand zitterte so heftig, daß ich nicht feststellen konnte, ob sie atmete. Schließlich tat ich, wovor mir graute: Ich fühlte ihren Puls, registrierte aber keinen. Kein Puls! Mein Gott, kein Puls! Dann sah ich ihren Puls. Ein kaum wahrnehmbares Pochen an ihren Schläfen, und als ich behutsam ihren Kopf zur Seite drehte, sah ich auch den Puls an der Halsschlagader. Sie lebte! Vielleicht würde sie nicht lange leben. Aber noch lebte sie.
Mit neuer Hoffnung untersuchte ich sie, hielt Ausschau nach Verletzungen. Ihr Skianzug war zerrissen, und die Krallen des Trolls hatten ihre linke Hüfte zerkratzt, wenn auch nicht allzu tief. Es kostete mich große Überwindung nachzuschauen, was die Ursache für das Blut im Mundwinkel war. Ich befürchtete, es könnte von inneren Verletzungen herrühren. Vielleicht hatte sie den ganzen Mund voll Blut. Aber das war nicht der Fall. Sie hatte sich die Lippe aufgeschlagen, weiter nichts. Abgesehen von den Prellungen im Gesicht schien sie überhaupt unverletzt zu sein.
»Rya?«
Nichts.
Ich mußte sie an die Erdoberfläche bringen, bevor weitere Schächte einstürzten, eine weitere Suchmannschaft Trolle auftauchte — oder bevor sie starb, weil sie nicht medizinisch versorgt wurde.
Ich schaltete eine Taschenlampe aus und schob sie in die tiefe Hosentasche, wo ich bisher die Pistole aufbewahrt hatte. Die Waffe würde ich nun nicht mehr benötigen, denn falls ich weiteren Trollen über den Weg lief, würde es um mich bestimmt geschehen sein, bevor ich sie alle liquidieren könnte, ganz egal, wie viele Pistolen ich bei mir hatte.
Ich trug Rya, da sie ja nicht laufen konnte. Meine rechte Wade war von den Krallen eines Trolls gezeichnet, ebenso meine Seiten. Aus den Wunden sickerte Blut. Mir taten alle Glieder weh, aber irgendwie trug ich Rya.
Schicksalsschläge verleihen uns durchaus nicht immer Kraft und Mut; manchmal zerbrechen wir an ihnen. Wir verspüren auch nicht in jeder Krisensituation einen Adrenalinstoß, der uns übermenschliche Kräfte verleiht, aber immerhin geschieht das so oft, daß es schon fast sprichwörtlich geworden ist.
Auch mir widerfuhr dies in jenen Minenschächten. Es war allerdings kein plötzlicher Adrenalinstoß jener Art, der einen Mann befähigt, nach einem Unfall ein Auto hochzustemmen, um seine eingeklemmte Frau zu befreien; es war auch nicht jener Adrenalinsturm , der einer Mutter die Kraft verleiht, eine verschlossene Tür aus den Angeln zu reißen und durch einen brennenden Raum zu rennen, um ihr Kind zu retten, ohne die Hitze auch nur zu spüren. Vielmehr war es so eine Art Tropfinfusion von Adrenalin, ein lang anhaltender Zustrom von Energie, der mich in die Lage versetzte, immer weiterzugehen.
Wenn man es richtig durchdenkt und sein eigenes Herz erforscht, ist es nicht die Gefahr des eigenen Todes, die uns am meisten ängstigt. Nein, keineswegs. Denken Sie doch selbst einmal darüber nach. Was uns am meisten ängstigt, was uns maßlos entsetzt, ist vielmehr der Tod geliebter Menschen. Der Gedanke an den eigenen Tod ist zwar nicht angenehm, nicht willkommen, aber er ist immerhin erträglich, denn mit dem Eintritt des Todes haben Schmerzen und Leiden ein Ende. Wenn man hingegen einen geliebten Menschen verliert, hält das Leiden an, bis man selbst zu Grabe getragen wird. Mütter, Väter, Ehemänner, Ehefrauen, Söhne und Töchter, Freunde — man verwindet ihren Verlust nie ganz, und das Gefühl der Einsamkeit nach ihrem Hinscheiden ist
Weitere Kostenlose Bücher