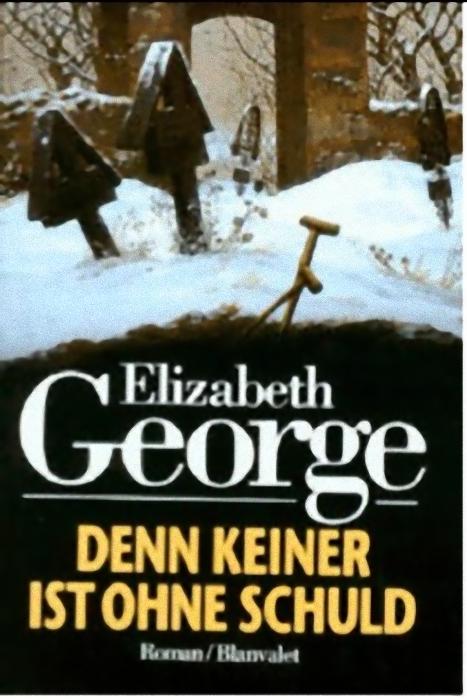![06 - Denn keiner ist ohne Schuld]()
06 - Denn keiner ist ohne Schuld
ihr dies zu verübeln.
Aber sie antwortete: »Ach, da bin ich aber froh.«
Und dann trat Schweigen ein. In diesem Schweigen konnte er sich vorstellen, wo sie war - in ihrem Schlafzimmer in der Wohnung am Onslow Square, auf dem Bett, die Beine untergeschlagen. Die in Gelb und Creme gehaltene Tagesdecke bildete einen schönen Kontrast zu ihrem Haar und ihren Augen. Er konnte sehen, wie sie den Telefonhörer hielt - mit beiden Händen umschlossen, als wollte sie ihn, sich selbst oder das Gespräch, das sie führte, schützen. Er wußte, welchen Schmuck sie trug - Ohrringe, die sie vielleicht schon auf dem Walnußtisch neben dem Bett abgelegt hatte, ein schmales goldenes Armband und eine dazu passende Halskette, die sie ab und zu mit der Hand berührte wie einen Talisman. Und aus dem Grübchen an ihrem Hals stieg der leise Duft des Parfüms empor, das sie benutzte, etwas Blumiges mit einem Hauch von Zitrus.
Sie begannen beide zugleich zu sprechen.
»Ich hätte nicht...«, sagte der eine.
»Ich war den ganzen Tag...«, der andere.
Und dann brachen sie mit einem raschen, nervösen Lachen ab, wie es oft Gespräche zwischen Liebenden begleitet, die beide fürchten, das zu verlieren, was sie gerade erst gefunden haben. Und das war der Grund, weshalb Lynley sämtliche Pläne, die er unmittelbar vor ihrem Anruf gemacht hatte, schlagartig aufgab.
»Ich liebe dich, Darling«, sagte er. »Die ganze Sache tut mir wirklich leid.«
»Bist du davongelaufen?«
»Diesmal, ja. In gewisser Weise.«
»Darüber darf ich mich dann nicht aufregen. Ich habe das ja selbst oft genug getan.«
Wieder Schweigen. Sie hatte wahrscheinlich eine seidene Bluse an und dazu eine Flanellhose oder einen Rock. Ihre Jacke lag vermutlich am Fußende des Bettes, wo sie sie hingeworfen hatte. Ihre Schuhe standen neben dem Bett. Das Licht brannte und beleuchtete sanft die Streifen und Blüten der Tapete und ihre Haut.
»Aber du bist nie fortgelaufen, um mir weh zu tun!«
»Ist das denn der Grund, weshalb du davongelaufen bist? Um mir weh zu tun?«
»Da kann ich wieder nur sagen, in gewisser Weise. Ich bin jedenfalls nicht stolz darauf.«
Er ergriff das Telefonkabel und schlang es nervös um seine Finger. Er sagte: »Helen, diese blöde Geschichte mit der Krawatte heute morgen.«
»Das war doch gar nicht der springende Punkt. Du hast es gleich gemerkt. Aber ich wollte es nicht zugeben. Es war nur ein Vorwand.«
»Wofür?«
»Angst.«
»Wovor?«
»Angst davor, vorwärts zu gehen, vermute ich. Dich noch mehr zu lieben, als ich es schon tue. Dich zu sehr in mein Leben einzubeziehen.«
»Helen...«
»Ich könnte mich in der Liebe zu dir leicht verlieren. Das Problem ist, daß ich nicht weiß, ob ich das will.«
»Wie kann denn so etwas schlimm sein? Kann es falsch sein?«
»Es ist weder das eine noch das andere. Aber der Liebe folgt früher oder später immer der Schmerz. Das ist so. Die Frage ist nur, wann. Und damit habe ich versucht, mich auseinanderzusetzen: ob ich den Schmerz will, und in welchem Maß. Manchmal...«
Sie zögerte. Er konnte sehen, wie sie in einer schützenden Geste die Hand an ihren Halsansatz legte, ehe sie fortfuhr. »Es ist dem Schmerz näher als alles, was ich je erlebt habe. Ist das nicht verrückt? Davor habe ich Angst. Ich glaube, ich habe tatsächlich Angst vor dir.« »Irgendwann mußt du anfangen, mir zu vertrauen, Helen, wenn wir gemeinsam weiterkommen wollen.«
»Das weiß ich.«
»Ich werde dir keinen Schmerz zufügen.«
»Absichtlich nicht. Nein, das weiß ich sehr wohl.«
»Aber?«
»Wenn ich dich verliere, Tommy.«
»Das wird nicht geschehen. Wie sollte es auch? Warum?«
»Ach, da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten.«
»Wegen meiner Arbeit?«
»Weil du der bist, der du bist.«
Er hatte ein Gefühl, als würde er von einer riesigen Welle fortgetragen, fortgetragen von allem, vor allem aber von ihr. »Es ist also doch die Krawatte«, sagte er.
»Andere Frauen?« erwiderte sie. »Ja. Am Rande. Aber es ist mehr eine Angst vor dem Alltag, vor dem täglichen Leben, vor der Art und Weise, wie die Menschen sich aneinander aufreiben. Ich will das nicht. Ich möchte nicht eines Morgens aufwachen und erkennen, daß ich bereits vor fünf Jahren aufgehört habe, dich zu lieben. Ich möchte nicht eines Abends vom Essen aufblicken und sehen müssen, daß du mich beobachtest, und auf deinem Gesicht genau das gleiche lesen.«
»Das ist das Risiko, Helen. Letztendlich läuft es darauf hinaus, Vertrauen
Weitere Kostenlose Bücher