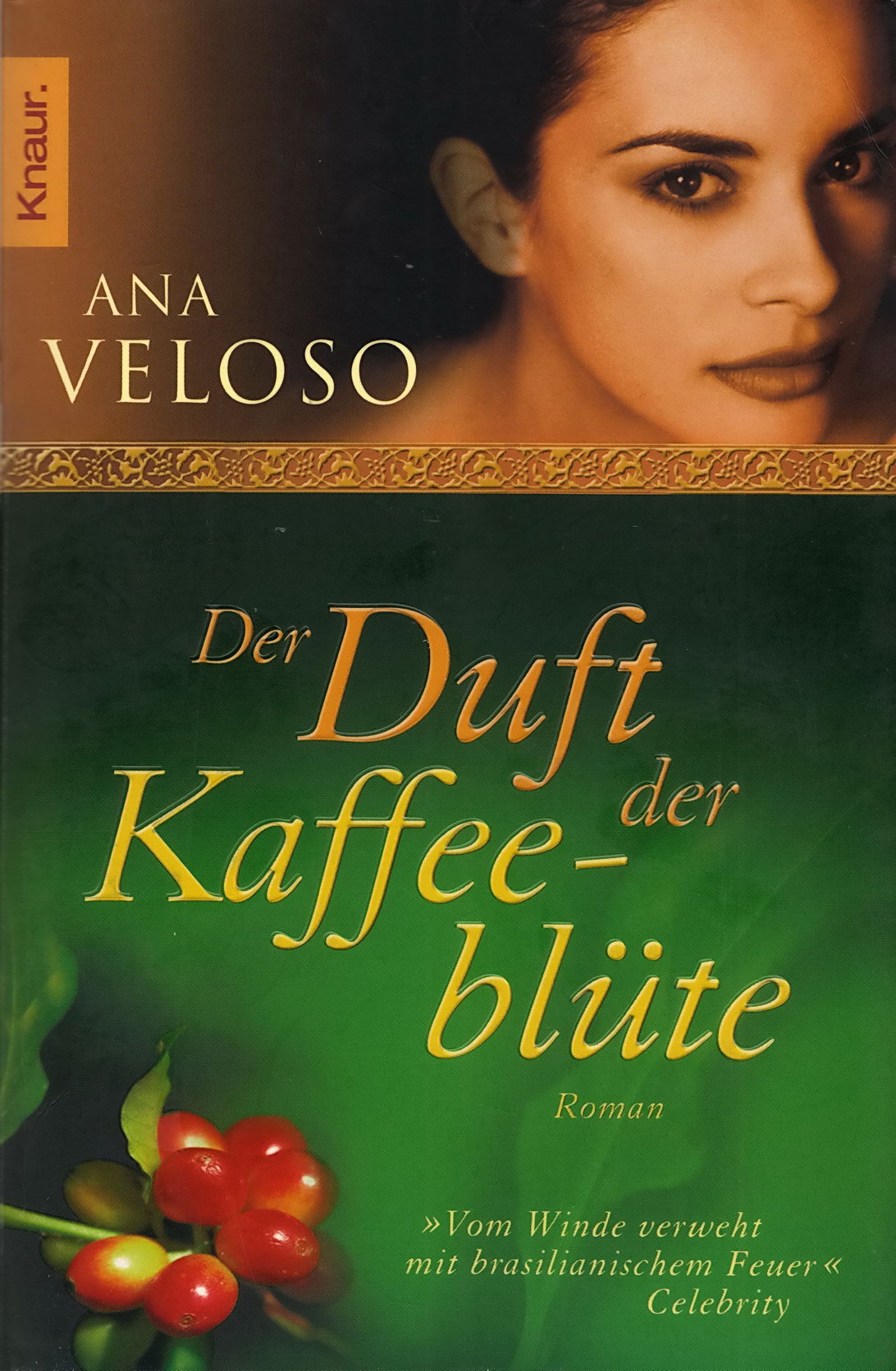![Ana Veloso]()
Ana Veloso
Fernanda sich
den Hof von Zeca machen ließ und ihn, Félix, vollkommen ignorierte, das ging
entschieden zu weit. Seit ihrer gemeinsamen Zeit auf Esperanca hatte für Félix
festgestanden, dass er und Fernanda zusammengehörten. In seinen Zukunftsplänen
hatte Fernanda einen festen Platz an seiner Seite. Irgendwann hatte er sogar
aufgehört, sich vor ihrem großen Busen zu fürchten, sondern hatte sich
vorgestellt, wie er sich wohl anfühlen würde. Seither war er davon ausgegangen,
dass Fernanda, auch ohne dass er mit ihr darüber gesprochen hätte, ihn als
ihren zukünftigen Ehemann betrachtete. Er wollte nur mit seinem Antrag warten,
bis er alt genug und in der Lage wäre, eine Familie zu ernähren. Warum hauste
er wohl in diesem schrecklichen Viertel, in dem es immer fünf Grad wärmer war
als unten am Meer? Warum wohl legte er jeden hart erarbeiteten Vintém beiseite?
Um eines Tages ein richtiges Haus bauen zu können, eines aus Stein und mit
einem Gartenzaun drum herum. In Fernandas Blicken, in ihrem Benehmen hatte er
Zustimmung gelesen. Was für ein Trugschluss! Jetzt machte sie diesem Zeca schöne
Augen, einem Mulatten, der sich dank eines Darlehens seines weißen Vaters die
Freiheit erkauft und sich als Schuster niedergelassen hatte. Und was das
Schlimmste war: Zeca war nicht nur erfolgreich – seine Schuhe waren preiswert
und von guter Qualität und fanden bei den einfachen Bürgern in der Innenstadt
reißenden Absatz –, sondern er sah auch noch gut aus. Ja, Geschmack hatte sie
ja, seine Fernanda. Aber konnte sich Zeca nicht um Gottes willen eine andere
Braut suchen? Er konnte jede haben, alle Mädchen und jungen Frauen in der
Siedlung waren verrückt nach ihm.
Félix schlenderte mit missmutiger Miene durch
die Lehmstraße. Er trat nach allem, was ihm in die Quere kam. Ein struppiger
Hund sprang bellend um ihn herum und bekam ebenfalls einen Tritt ab. Jaulend
und mit eingezogenem Schwanz verdrückte er sich. Ein paar verdreckte Kinder
spielten mit Glasmurmeln, von denen eine direkt vor seine Füße rollte. Auch sie
wurde in hohem Bogen weggeschossen, und die Schimpftiraden der Kinder hallten
durchs ganze Viertel. »Hurensohn!«, hörte er sie schreien, und »Kanaille!«.
Woher sie nur solche Wörter wussten? Félix war sich ziemlich sicher, dass er in
ihrem Alter noch nicht solche Kraftausdrücke gekannt hatte. »Verlaustes
Gesindel!«, dachte er und ärgerte sich, dass er die Kinder nicht laut und unflätig
beschimpfen konnte, in der einzigen Sprache, die sie verstanden. Sie konnten
froh sein, dass er ihnen die Murmeln nicht fortnahm, von denen er annahm, dass
sie sie irgendwo gestohlen hatten.
Jeder im Viertel wusste, dass die Kinder,
insbesondere die Jungen zwischen sieben und vierzehn Jahren, sich zu Banden
zusammenschlossen und in der Innenstadt alles stahlen, was nicht niet- und
nagelfest war. Die Polizei kam in regelmäßigen Abständen in ihr Viertel, und
ebenso regelmäßig fand sie bei ihren Durchsuchungen Diebesgut. Die Beweislage
war allerdings schwierig, denn die Jungen stahlen neben Lebensmitteln meist nur
Gegenstände, die für ihre Besitzer von geringem Wert waren. Wie sollte man
ihnen nachweisen, dass sie einen glänzenden neuen Topf, ein besonders starkes
Seil, ein Kleidungsstück von guter Qualität nicht auf rechtmäßige Weise
erworben hatten? Die Jungen kamen fast immer ungeschoren davon, doch für die
anderen Bewohner der Armensiedlung war die ständige Präsenz der Polizei eine
unzumutbare Belastung. Immerzu wurden sie ausgefragt, wurden ihre Behausungen
auf den Kopf gestellt, mussten sie sich behandeln lassen wie gemeine
Verbrecher. Und für Félix, Fernanda und andere ehemalige Sklaven, denen die
Flucht geglückt war, bedeuteten diese Visiten eine noch viel größere Tortur.
Obwohl die Wahrscheinlichkeit, nach so langer Zeit noch gesucht zu werden,
gering war, fürchteten sie sich weiterhin vor der Ergreifung. Fernanda, die mit
durchschnittlicher Statur und einem Gesicht ohne auffallende Merkmale kaum
Gefahr lief, erwischt zu werden, war die Einzige, die sich in solchen
Situationen nicht versteckte. Sie blieb ganz ruhig, wenn einer der Gesetzeshüter
sie befragte. »Nein, Tenente, ich kenne hier niemanden, der Ihrer Beschreibung
entspricht.« Oder: »Nein, Delegado, ich glaube nicht, dass hier entflohene
Sklaven wohnen. Wenn ich aber davon erfahren sollte, werde ich Ihnen
selbstverständlich sofort Meldung erstatten.«
Es war nicht Kaltblütigkeit, die ihr diese
Gelassenheit
Weitere Kostenlose Bücher