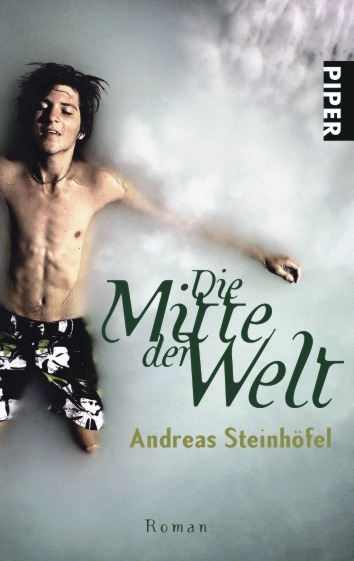![Andreas Steinhofel]()
Andreas Steinhofel
wäre wieder im alten Keller der Schule. Ich stand vor einem
Regal voller gläserner, mit Formalin gefüllter Bottiche. Die
Bottiche waren sorgfältig abgestaubt, und in einem von ihnen
trieb, wie schwerelos in der schmutzig gelben Flüssigkeit, ein
zart geädertes, schlafendes Baby, die winzigen Fäuste vors
Gesicht gepresst, die Beinchen angewinkelt. Plötzlich färbte
sich die Flüssigkeit rot, das Baby öffnete schreiend die Augen,
es hatte die weiten, blauen Augen von Glass.
Dianne schlief neben mir wie ein Stein. Aber Tereza wurde
von meinem Weinen angelockt. Sie nahm mich kurzerhand mit
in ihr eigenes Bett, wo sie beruhigend auf mich einredete.
»Stell dir das Leben vor wie ein großes Haus mit vielen
Zimmern, Phil. Einige dieser Zimmer sind leer, andere voller
Gerümpel. Manche sind groß und voller Licht, und wieder
andere sind dunkel, sie verbergen Schrecken und Kummer. Und
ab und zu – nur ab und zu, hörst du? – öffnet sich die Tür zu
einem dieser schrecklichen Zimmer und du musst hineinsehen,
ob du willst oder nicht. Dann bekommst du große Angst, so wie
jetzt. Weißt du, was du dann tust?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Dann denkst du daran, dass es dein Leben ist – dein Haus,
mit deinen Zimmern. Du hast die Schlüssel, Phil. Also schließt
du die Tür zu diesem schrecklichen Zimmer einfach zu.«
»Und dann werfe ich den Schlüssel weg!«
»Nein, das darfst du nicht tun, niemals«, erwiderte Tereza
ernst. »Denn eines Tages spürst du vielleicht, dass nur durch
dieses schreckliche Zimmer der Weg in einen größeren,
schöneren Teil des Hauses führt. Und dann brauchst du den
Schlüssel. Du kannst deine Angst für eine Weile aussperren,
aber irgendwann musst du dich ihr stellen.«
»Wenn ich größer bin?«
»Größer und mutiger, mein Kleiner.« Tereza streichelte mir
mit dem Handrücken über die Schläfe. »Und vielleicht auch
nicht mehr allein.«
Ich brannte darauf, meine Mutter im Krankenhaus zu
besuchen, weil ich mich mit eigenen Augen davon überzeugen
wollte, dass sie noch lebte. Aber weil sie viel Blut verloren hatte
und außerdem irgendetwas mit ihrem Unterleib nicht stimmte,
war Glass absolute Ruhe verordnet worden, so dass während der
ersten Tage nur Tereza sie sehen durfte. Und so blieb ich, trotz
aller Beteuerungen Terezas, dass das Schlimmste überstanden
sei, unruhig. Bisher hatte ich geglaubt, es gebe kaum etwas
Schlimmeres, als ein Leben ohne Vater zu führen. Jetzt überfiel
mich der Gedanke an den Alptraum eines Lebens ohne Eltern –
hätte Glass die Fehlgeburt nicht überlebt, wären Dianne und ich
zu Waisen geworden. Etwas wie Dankbarkeit keimte in mir auf.
Das Baby, ein Bruder oder eine Schwester, war verloren, aber
Glass war immer noch da. Doch bei allem Wissen darum, dass
im Falle ihres Todes Tereza Himmel und Hölle in Bewegung
gesetzt hätte, um Dianne und mich bei sich zu behalten, erfüllte
mich die Vorstellung eines Lebens ohne meine Mutter mit
einem Terror, der mich nie wieder ganz verlassen sollte. Noch
Wochen nach ihrer Rückkehr entwarf ich Szenarien, in denen
Glass auf die unsinnigsten Arten zu Tode kam, und auf
geheimnisvolle Art und Weise tauchte in diesen Phantasien
immer wieder das Tuch auf, das Tereza die Treppen Visibles
herabgetragen hatte, das zerknüllte Laken mit dem leuchtend
roten Blutfleck. Ich sah Glass darin eingewickelt wie in eine
Toga oder einen Sari, sah sie ganz davon bedeckt wie von
einem Leichentuch; ich sah es als entsetzlichen Turban um
ihren Kopf geschlungen.
Tereza tat ihr Möglichstes, Dianne und mir die Zeit zu
vertreiben. Am dritten oder vierten Tag steckte sie uns
frühmorgens ins Auto und nahm die Stunden dauernde Anfahrt
in irgendeine große Stadt auf sich, um schließlich mit uns vor
den geschlossenen Pforten des Zoos zu stehen, in den sie uns
hatte führen wollen.
»Zoos haben im Winter zu«, war Diannes lakonischer
Kommentar. Es war der erste Satz, den sie seit der
schrecklichen Nacht in Visible von sich gab. Ich atmete
erleichtert auf. Bisher war ich mir nicht sicher gewesen, ob ihr
einfach die Worte fehlten, sich mir mitzuteilen, oder ob der
Schock angesichts der Ereignisse sie der Sprache beraubt hatte.
Nur dass Tereza dieser Sprachlosigkeit mit Gelassenheit
begegnet war, hatte mich einigermaßen beruhigt.
»Natürlich«, sagte Tereza jetzt und nickte. »Natürlich sind
Zoos im Winter geschlossen.« Sie setzte sich auf eine
verschneite Bank und brach in Tränen
Weitere Kostenlose Bücher