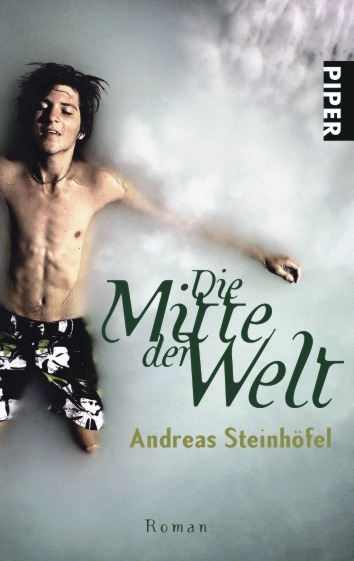![Andreas Steinhofel]()
Andreas Steinhofel
Tereza. »Der dicke
Mann hat auf meinen toten Papa aufgepasst, und den holen wir
jetzt ab.«
»Warum denn?«
»Weil wir ihn beerdigen wollen, Schätzchen. Tote Menschen
werden beerdigt.«
Es war kalt geworden, so kalt, dass Tereza von Zeit zu Zeit
die beschlagene Windschutzscheibe mit dem Ärmel ihrer Jacke
freiwischen musste, und der sturmzerrissene Himmel versprach
Regen. Von unserem Platz auf dem Rücksitz konnten Dianne
und ich die Auslage im kleinen Schaufenster des Instituts sehen.
Bis heute finde ich, dass es kaum einen deprimierenderen
Anblick gibt als den der wenigen Güter, die ein Leichenbestatter
als Insignien seines Gewerbes zur Schau stellen kann: mit Samt
ausgeschlagene Särge aus Holz oder Kunststoff, die immer
irgendwie zu kurz aussehen, Urnen, die wie einsame kleine
Könige auf einem Piedestal thronen, und irgendwo dazwischen
ein Poster mit dem Hinweis, dass man auch Seebestattungen
durchführe, Friede sei mit euch, und sind Sie für den Fall der
Fälle versichert?
Es war natürlich nicht der Fall der Fälle, der, wie Glass H.
Hendriks im Inneren des Hauses erklärte, sie bei Wind und
Wetter zu ihm trieb, sondern der Professor, einer der wenigen
guten alten Freunde der Familie.
»Ich sagte Hendriks, so ungefähr«, erzählte sie an jenem
Sommerabend auf der Veranda, »dass ich mich vom alten Mann
verabschieden wolle, aber nicht erst auf dem Friedhof, wegen
der Leute, er wisse schon.«
Es war ein klassisches Beispiel dafür, dass auch ein schlechter
Ruf von Nutzen sein kann.
Der feiste H. Hendriks hörte Glass zu, während sein Blick
immer wieder von ihrem Gesicht zu der Stelle über ihrem Busen
fiel, wo der Mantel ein wenig aufklaffte und freie Aussicht auf
die weißen Spitzen gewährte. Glass ließ sich von ihm durch das
Haus führen, das der Bestatter ganz allein bewohnte; der
Assistent mit dem hüpfenden Adamsapfel kam nur tagsüber zur
Arbeit. H. Hendriks zögerte, als Glass die Räume zu sehen
verlangte, in denen er die Leichen wusch, ankleidete und
schminkte.
»Üblich ist das nicht«, knotterte er.
»Aber Sie sind auch keiner der üblichen Männer, das sind Sie
doch nicht, oder?«, singsangte Glass, und H. Hendriks schluckte
und nickte und setzte sich in Bewegung wie ein
schwergewichtiges Aufziehmännchen.
In dem gekachelten Raum, in den er Glass führte, befanden
sich, aufgepflockt auf einfache Holzböcke, zwei mächtige,
verschlossene Särge aus dunklem Eichenholz. Sie glichen
einander wie ein Ei dem anderen. Glass war verwirrt; als folge
der Tod einem genau kalkulierten Stundenplan von einem Toten
pro Tag oder pro Woche, war sie wie selbstverständlich davon
ausgegangen, in Hendriks Institut nur auf Terezas Vater zu
treffen. Jetzt deutete sie zaghaft auf den linken Sarg.
»Ist das der…«
H. Hendricks nickte feierlich.
»Und ist er… er ist doch fix und fertig… zurechtgemacht, sagt
man das so, für die Beerdigung? Oder wird der Sarg noch mal
geöffnet?«
»Die Kiste bleibt zu«, erwiderte Hendricks bestimmt. »Die
Tochter hat das so verfügt.«
Glass nickte. Jede andere Antwort wäre für sie das Signal
gewesen, sich rasch zu verabschieden. Sie atmete tief ein und
wieder aus, und wie zufällig rutschte ihr Mantel über dem
Busen noch ein wenig weiter auseinander. In H. Hendriks
Augen trat ein unbestimmter Glanz, während Glass die Hände
faltete, eine Minute lang schweigend wie im Gebet verharrte –
sie betete tatsächlich, aber nicht, wie H. Hendriks annehmen
musste, für den toten Professor – und dann den vor Nervosität
auf den Zehenspitzen wippenden dicken Mann fragte, ob er
wohl etwas für sie zu trinken hätte.
»Wasser?«, bot Hendriks arglos an.
»Wodka«, sagte Glass trocken.
H. Hendriks führte sie durch das Haus in sein Wohnzimmer,
wo er ebenso eilfertig wie unbeholfen eine volle Wodkaflasche
und zwei Gläser anschleppte, die er sofort füllte, randvoll. Glass
setzte sich auf ein mit plüschigen Kissen hoffnungslos
überladenes Sofa, raffte ihren Mantelsaum, schlug die Beine
übereinander, bekundete, es ginge ihr schon viel besser, und bat
Hendriks darum, ihr nun doch einen klitzekleinen Schluck
Wasser zu holen.
»Peinlich!« Glass schüttelte sich noch im Nachhinein bei der
Erinnerung an ihren Auftritt als Verführerin. »Peinlich wie
sonst nichts, dieses Getue als blondes Dummchen, das kann ich
euch sagen!«
Während der Leichenbestatter in der Küche zugange war,
schüttete sie das von Terezas Hausarzt
Weitere Kostenlose Bücher