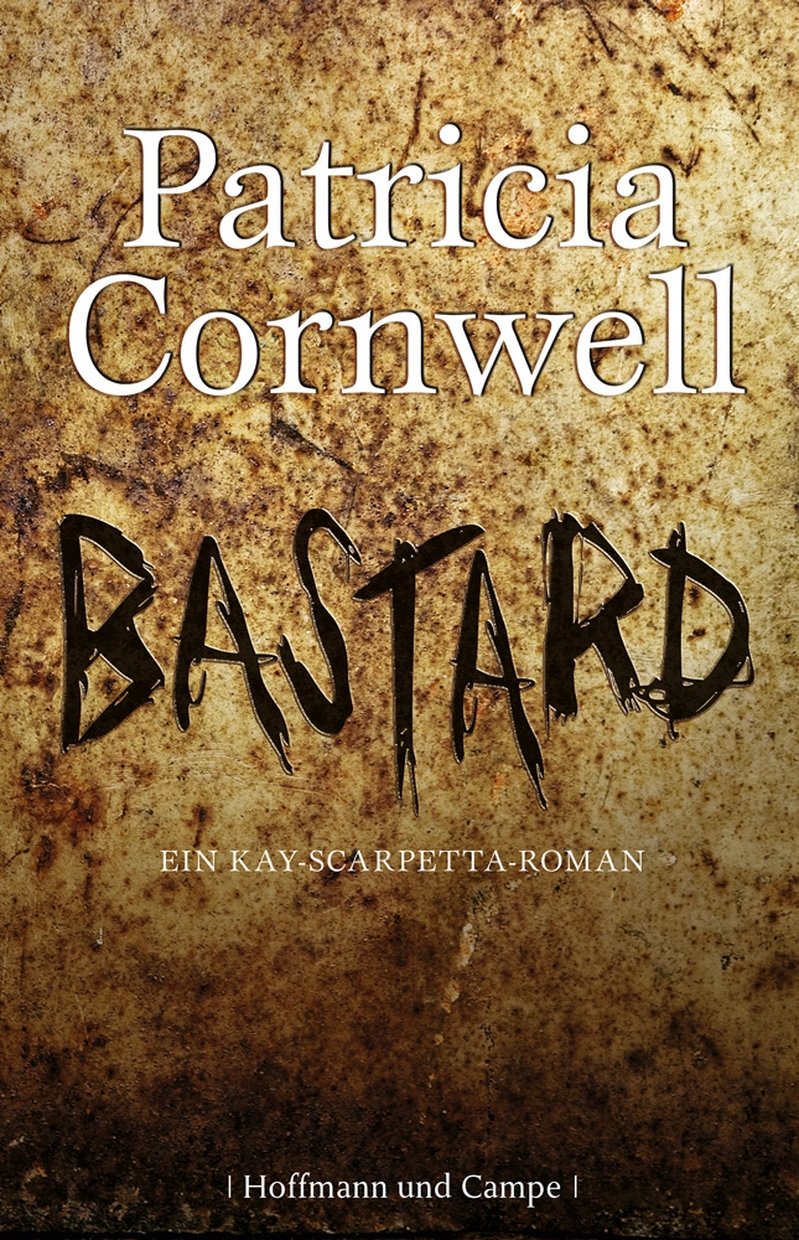![Bastard]()
Bastard
hier einen Brief, der angeblich von Ihnen ist«, wiederhole ich anstelle einer Antwort. »Er wurde mit der Schreibmaschine getippt.«
»Ich benutze tatsächlich noch eine Schreibmaschine«, entgegnet sie überrascht. »Aber für gewöhnlich schreibe ich Briefe mit der Hand.«
»Dürfte ich erfahren, womit?«
»Na, mit einem Füller natürlich. Einem Füllfederhalter.«
»Und welchen Schrifttyp hat Ihre Schreibmaschine? Doch vielleicht wissen Sie das ja auch nicht. So geht es vielen.«
»Es ist eine Reiseschreibmaschine von Olivetti, die ich schon seit einer Ewigkeit habe. Die Schrift ist kursiv wie eine Handschrift.«
»Also noch eine manuelle. Die muss ja schon ziemlich alt sein.« Ich betrachte den Brief und die Kursivschrift, erzeugt von Typen aus Metall, die gegen ein Farbband schlagen.
»Sie gehörte meiner Mutter.«
»Mrs. Donahue, können Sie mir sagen, wo Ihre Schreibmaschine derzeit ist?«
»Ich gehe gerade zu dem Schrank in der Bibliothek, wo ich sie aufbewahre, wenn ich sie nicht brauche.«
Ich höre, wie sie sich durchs Haus bewegt. Dann ein Geräusch, als würde ein schnurloses Telefon auf einer harten Fläche abgelegt. Danach werden einige Türen geschlossen, vielleicht die eines Schranks. Kurz darauf ist sie wieder am Apparat. »Sie ist verschwunden. Sie steht nicht mehr an ihrem Platz«, verkündet sie, beinahe atemlos.
»Erinnern Sie sich, wann Sie sie zuletzt gesehen haben?«
»Keine Ahnung. Es ist schon Wochen her. Wahrscheinlich so gegen Weihnachten, aber ich bin nicht sicher.«
»Und die Maschine könnte auch nirgendwo anders sein? Vielleicht haben Sie sie ja umgestellt, oder jemand hat sie sich ausgeliehen?«
»Nein. Das ist ja entsetzlich. Jemand hat meine Schreibmaschine gestohlen. Und vermutlich auch mein Briefpapier. Und zwar dieselbe Person, die Ihnen unter meinem Namen einen Brief geschrieben hat. Ich war es nämlich ganz sicher nicht.«
Der Erste, der mir einfällt, ist ihr Sohn Johnny. Aber der ist im McLean. Er hätte auf keinen Fall ihre Schreibmaschine, ihren Füller und ihr Briefpapier entwenden und dann einen
Mann mit Bentley damit beauftragen können, mir einen Brief zu überbringen. Vorausgesetzt, er hätte überhaupt die Möglichkeit gehabt, herauszufinden, wann ich am gestrigen Abend in Lucys Hubschrauber eintreffen würde. Doch darauf werde ich seine Mutter auch nicht ansprechen. Mit jeder Frage liefere ich ihr nur weitere Informationen.
»Was steht in dem Brief?«, beharrt sie. »Was hat die Person geschrieben, die getan hat, als wäre sie ich? Wer hätte meine Schreibmaschine stehlen können? Sollen wir die Polizei verständigen? Was rede ich da. Sie sind ja die Polizei.«
»Ich bin Rechtsmedizinerin«, verbessere ich sie sachlich, während ein schnelleres Stück von Chopin, eine andere Etüde, erklingt. »Ich bin nicht die Polizei.«
»Eigentlich schon. Ärzte wie Sie ermitteln doch wie Polizisten, verhalten sich wie Polizisten und haben Macht, die sie missbrauchen können, wie Polizisten. Ich habe mit Dr. Fielding über das gesprochen, was meinem Sohn zur Last gelegt wird, aber darüber sind Sie sicher ohnehin im Bilde. Bestimmt wissen Sie, dass ich deshalb in Ihrem Institut angerufen habe. Sie müssen es einfach wissen und auch, was für ein schrecklicher Irrtum es ist. Sie klingen wie eine Frau, der Gerechtigkeit etwas bedeutet. Mir ist klar, dass Sie nicht hier waren. Allerdings begreife ich nicht, wie Sie so etwas, selbst aus der Entfernung, haben durchgehen lassen können.«
Ich drehe meinen Stuhl zu der gewölbten Wand hinter mir um, die ganz und gar aus Glas besteht. Mein Büro hat dieselbe Form wie das ganze Gebäude. Wenn man es auf die Seite legen würde, hätte man eine Walze mit einer Kuppel am einen Ende. Der Morgenhimmel ist strahlend blau. Knallblau, wie Lucy sagen würde. Ich bemerke, dass sich auf dem Überwachungsvideo etwas bewegt. Ein schwarzer SUV parkt hinter dem Haus.
»Man hat mir mitgeteilt, dass Sie ihn angerufen haben«,
erwidere ich, weil ich nicht aussprechen darf, was mir so drängend auf der Zunge liegt. Was ist ungerecht? Was habe ich durchgehen lassen? Wie hat sie erfahren, dass ich nicht da war? »Ich verstehe ja, dass Sie in Sorge sind, aber …«
»Ich bin nicht auf den Kopf gefallen«, unterbricht mich Mrs. Donahue. »Ich lebe nicht hinterm Mond, obwohl ich bis jetzt noch nie in eine so schreckliche Sache verwickelt war. Allerdings hatte er keinen Grund, so unhöflich zu mir zu sein. Es war mein Recht, diese Frage
Weitere Kostenlose Bücher