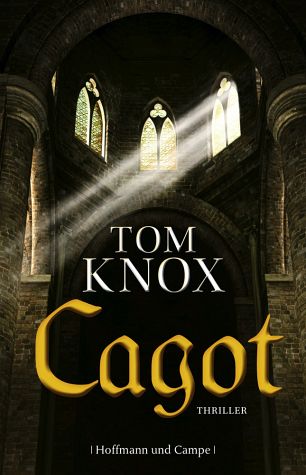![Cagot]()
Cagot
Gefühle, die ihn die ganze Nacht geplagt hatten, die gleichen Gefühle, die ihn die ganze Woche geplagt hatten. Würde er vielleicht nie wieder tief und fest schlafen können? Jedenfalls nicht ohne einen Drink. Nicht ohne viele Drinks. Er hatte Angst - und ein schlechtes Gewissen. Und schreckliche Langeweile. Nach dem Mord an Fazackerly hatte ihn der Redakteur von der Story abgezogen, weil die Sache zu haarig geworden war: »Und wenn sie es als Nächstes auf dich abgesehen haben, Simon? Was, wenn deine Artikel den Mördern wichtige Hinweise liefern?«
Einsam stand Simon am Fenster und starrte auf die vorbeigleitenden Fahrzeuge hinab. Ein Auto raste viel zu schnell auf die Ampel zu und kam mit quietschenden Reifen zum Stehen. Simon bekam den üblichen Anfall elterlicher Wut: Musst du so schnell fahren, du Idiot, ich habe einen kleinen Sohn. Und dann verspürte er wieder den Stich des schlechten Gewissens. Wer gefährdete seinen Sohn wirklich? Wer brachte sein junges Leben tatsächlich in Gefahr? Wer hatte seine Familie in eine derart gefährliche Nähe zu Tod und Chaos gebracht?
Er selbst. Der Vater. Der karrieregeile Journalist. Ganz allein er.
Simon wusste, dass er in Gefahr schwebte. Im Moment brauchte er so dringend einen Drink wie schon seit Jahren nicht mehr. Er setzte seine schwer erkämpfte Nüchternheit aufs Spiel. Aber was sollte er sonst tun? Ihm war nicht danach, zu einem NA-Treffen zu gehen.
Er ging ins Bad und duschte extrem heiß, putzte sich die Zähne, zog sich an, und als er danach ins Schlafzimmer zurückkehrte, fühlte er sich geringfügig besser.
Vielleicht war es gar nicht seine Schuld.
Natürlich war es seine Schuld.
Vielleicht war nicht alles seine Schuld.
Er fuhr sein Notebook hoch, ging online und sah sich noch einmal die Mails von Tomasky und Sanderson an, die sich mit Fazackerlys Tod und mit der seltsamen Abfolge der Ereignisse und ihren Konsequenzen befassten.
Kurz nachdem Simon den Professor in der Mikrowelle seines eigenen Labors gefunden hatte, war, von seinem Anruf alarmiert, die Polizei angerückt. Sie hatten den stammelnden Journalisten rasch nach draußen geführt, ihn erst einmal zu beruhigen versucht und schließlich vernommen. Danach hatten sie ihm sogar ein paar Sitzungen bei einem Spezialisten für die Bewältigung traumatischer Erlebnisse verschafft.
Trotzdem war Simon noch traumatisiert von der grausigen Szene im GenoMap-Labor. Indem er den Ermittlern per Mail und Telefon Fragen stellte, versuchte er das Erlebte zu verarbeiten. Tomasky empfand er als den besten Ansprechpartner. Der tiefe katholische Glauben des stets gutgelaunten Polen hatte etwas sehr Aufbauendes; auch sein schwarzer Humor war manchmal durchaus heilsam: bissige Kommentare über den Tod, der »ungefähr genauso schlimm ist wie ein Wochenende in Katowice«.
Tomasky und Sanderson hatten Simon die »Logik« von Fazackerlys Tod auseinanderzusetzen versucht. Den alten Wissenschaftler in der Mikrowelle zu töten war clever und enorm effizient gewesen. Lautlos und rasch, hinterließ es weder Schusswunden noch DNS-Spuren. Pech hatte der Mörder nur insofern gehabt, als Fazackerlys leistungsstarkes Handy auch in der Metallkiste Empfang gehabt hatte.
Und doch. In Simons Augen trug das Ganze trotz allem Züge einer ausgefallenen mittelalterlichen Folter - jemanden bei lebendigem Leib in der Mikrowelle zu garen, das Blutplasma buchstäblich in seinen eigenen Adern zum Kochen zu bringen.
Er schloss die E-Mails mit einem aus tiefstem Herzen kommenden Seufzer. Die Beschäftigung mit all dem Blut erinnerte ihn an seinen Bruder; an Tim zu denken war deprimierend und zugleich motivierend. Sein Bruder würde vermutlich sein Leben lang in eine Anstalt weggesperrt bleiben. Daher war Simon der einzige Quinn mit Nachkommenschaft und Zukunft. Er trug Verantwortung. Er musste Geld verdienen und arbeiten und seinen Namen weitergeben.
Bei diesem Gedanken spürte Simon, wie Stolz, Selbstachtung und sogar Wut in ihn zurückkehrten. Er musste sich zusammenreißen: Fazackerlys Tod war nicht seine Schuld. Wer konnte schon sagen, ob es wirklich seine Artikel gewesen waren, die den Täter auf die Spur des Professors gebracht hatten? Dafür konnte es genauso gut andere Gründe geben. Wie auch immer - er war Journalist und tat nur seine Arbeit. Und wie es sich für einen guten Reporter gehörte, ging er jeder Spur nach. Die Gefahr, der seine Familie dadurch ausgesetzt wurde, zerriss ihm das Herz - aber wie sollte er sie sonst
Weitere Kostenlose Bücher