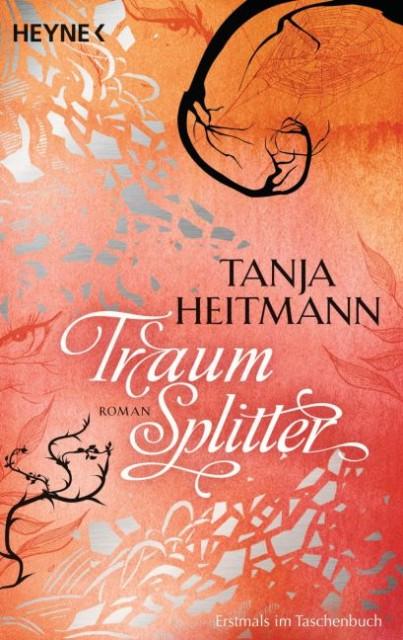![Dämonen-Reihe Bd. 4 Traumsplitter]()
Dämonen-Reihe Bd. 4 Traumsplitter
gedachte, denn auch das begriff er auf den ersten Blick: Bernadette reizte man besser nicht, in ihren Augen lag eine gewisse Härte. Sicherlich schlug ihre Laune schneller um als das Wetter an der Küste.
»Nun, wie sieht es aus: Willst du dir einen Penny verdienen, Gabriel?«, hakte sie nach.
»Ich will ja nicht wie ein schlechter Geschäftsmann klingen, aber ein Penny für meine Gedanken wäre definitiv zu viel. Die kreisen nämlich einzig und allein um den Satz: Hier ist es heißer als in der Hölle.«
»Wirklich?« Das klang nicht sonderlich überzeugt. »Dabei habe ich geglaubt, ein leises Ticken hinter deiner Stirn zu vernehmen. Das Chronometer der Angst. Ticktack, deine Zeit läuft ab.«
Während Bernadette ihren Zeigefinger wie ein Pendel bewegte, zwang Gabriel seine
Mundwinkel zu einem Lächeln. »Also wirklich, Bernadette. Und dabei dachte ich immer, unsere Sorte würde in die charmante Schublade gehören.«
Bernadette hob ihr kastanienfarbenes Haar und gab den Blick auf ihren wohlgeformten
Nacken und die Schulternfrei. »Wenn du glaubst, dass dir dein Charme in dieser Situation weiterhilft – nur zu. Ich hingegen glaube, dass du viel zu sehr in der Klemme sitzt, um darauf zu zählen.«
Ja, darauf konnte Bernadette Gift nehmen, nur würde Gabriel einen Teufel tun und das eingestehen. »Reib es mir ruhig unter die Nase, meine Gute. Falls du damit den Preis für deine Hilfe in die Höhe treiben willst, muss ich dir leider gestehen, dass bei mir nicht viel zu holen ist. Das ist alles schon verpfändet.«
Bernadette schnaubte belustigt. »Als ob ich ein Interesse an deinem Seelenleben hätte.«
Warum auch? Schließlich hast du dich schon ausreichend daran bedient, bevor du mir den Weg gezeigt hast, einen Teil von mir gegen etwas viel Spannenderes einzutauschen.
Allerdings ohne mir zugleich von den Folgewirkungen zu erzählen, weshalb ich hier jetzt ja als Bittsteller stehe, hätte Gabriel ihr allzu gern vorgehalten. Gerade noch rechtzeitig riss er sich zusammen. Obwohl er das Bedürfnis verspürte, ihr die Wahrheit und seine Wut ins Gesicht zu sagen, war ihm bewusst, dass er sich seine Lage selbst zuzuschreiben hatte.
Bernadette hatte ihm damals lediglich den Weg gewiesen, gegangen war er ihn von ganz allein. Er war kein Verführter, und deshalb blieb ihm auch nichts anderes übrig, als die Verantwortung für seine Dummheit allein zu tragen.
»Sandfern ist ein hübsches Städtchen, aber irgendwie hätte ich eher darauf getippt, dass du der Großstadttyp bist«, versuchte Gabriel, dem Gespräch eine andere Wendung zu
geben.
Bernadette zuckte mit den Schultern. »Ich fühle mich eben an Sandfern gebunden.« Ihr Blick huschte zu den vor Anker liegenden Segelschiffen.
»Sag bloß, du segelst?« Allein ihre komplizierten Riemchensandalen mit Bleistiftabsätzen schienen genau das Gegenteil zu schreien.
»Nur wenn ich muss«, erwiderte Bernadette trocken.
Gabriels Blick wanderte zu den Schiffen, auf der Suche nach irgendwas in Creme und
einem dicken Markenstempel anstelle eines Bootsnamens, ein Bernadette-Schiff quasi.
Stattdessen blieb sein Blick an einer aufwendig restaurierten Segeljacht hängen. Auf dem Deck stand ein älterer Herr mit eisgrauem, zurückgebundenem Haar, der ihm zunickte. Das war doch … vor Gabriels geistigem Auge tauchten längst verblichene Zeitungsartikel auf.
Dieser ältere Herr, dem man selbst auf diese Entfernung seine distinguierte Art ansah, wie hieß er noch einmal? Doch Gabriel kam nicht auf den Namen, brachte mit ihm nur etwas mit klassischer Musik in Verbindung.
»Irgendwie kommt mir der Herr bekannt vor. Wie heißt er?«
Bernadette sah noch kurz mit eisiger Miene zur Segeljacht, dann wendete sie sich abrupt ab. »Ich bin nicht hier, um alle deine Bildungslücken zu füllen.«
Sehr freundlich. »Lass mich raten: Der Herr ist dein Daddy, und er erwartet dich einmal die Woche pünktlich zum Segeltörn, ansonsten friert er das Familienerbe ein.«
Es sollte bestenfalls ein kleiner Seitenhieb sein, aber Bernadettes Ausdruck verriet, dass er sich den besser gespart hätte.
»Gut, dass dir trotz deiner verheerenden Situation nicht der Humor abhandengekommen
ist.«
»Ich wollte dir nicht auf die Füße treten. So, wie ich dich einschätze, brauchst du bestimmt niemanden, der dir unter die Arme greift.«
»Womit du genau richtigliegst, im Gegensatz zu dirbrauche ich tatsächlich niemanden, der mir hilft.«
Gabriel schluckte … unter anderem auch an seinemStolz,
Weitere Kostenlose Bücher