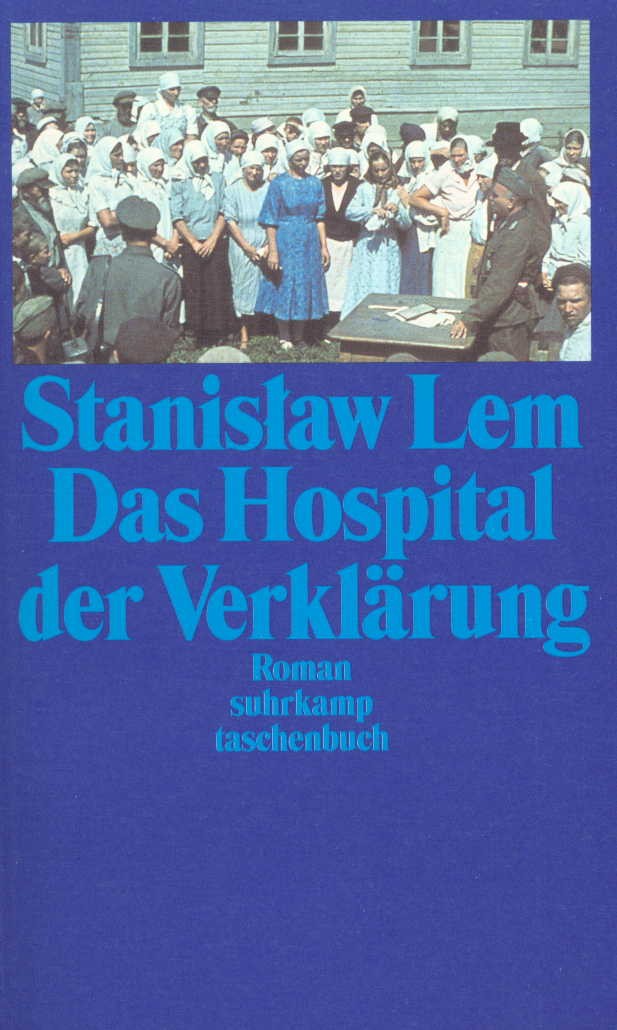![Das Hospital der Verklärung.]()
Das Hospital der Verklärung.
irgendeinem Advokaten. Dann kam sie endlich auf Stefans Vater zu sprechen. Mit wahrem Vergnügen stürzte sie sich in eine detaillierte Schilderung der letzten Monate. Sie entwarf das Bild eines verkannten, unglücklichen, obendrein von Herz- und Nierenkrankheiten geplagten Genies. Obgleich nur eine entfernte Verwandte, war sie die einzige, die sich dieses großen Erfinders angenommen hatte. »Dein Vater«, sagte sie, und dann noch einmal: »Dein Vater …«, so daß Stefan bereits argwöhnte, sie tue das aus Gehässigkeit und werfe ihm mangelnde Kindesliebe vor. Aber weit gefehlt. Sie fühlte einfach aus ganzer Seele mit. Vor Jahren war sie einmal schön gewesen. Und Stefan war einst sogar in ihr Foto verliebt, das er aus ihrem Zimmer entwendete. Jetzt hatte der reichliche Fettansatz die Reste ihrer Schönheit überwuchert.
Nachdem er gegessen und sich gewaschen hatte, durfte er das Schlafzimmer betreten.
Die Tante spielte den Boten und lief einige Male auf Zehenspitzen hinein und wieder heraus. Sie ruderte dabei mit den Armen als böte ihr die Luft Widerstand. Die Stimmung war erhaben. Mehr oder weniger wie die Rückkehr des verlorenen Sohnes, dachte Stefan und trat ebenfalls unwillkürlich auf Zehenspitzen ein, während in seiner Phantasie die Umrisse des braungetönten Rembrandtbildes zerflatterten.
Wie ihm gleich auffiel, war Mutters Kollektion vonGummibäumen, Zierspargeln und anderem Grünzeug erbarmungslos in den finstersten Winkel des Zimmers verbannt worden. Der Vater lag im Bett, die Decke bis übers Kinn heraufgezogen. Nur die zitronengelben, gekrümmten Finger hielten delikat den Saum fest wie häßliche tote Ziergebilde.
»Wie geht es dir, Vater?« murmelte Stefan.
Der Vater schwieg. Stefan war verlegen. Gern hätte er seinen Besuch rasch und im besten Einvernehmen erledigt. Wie gut wäre es, dachte er, wenn der Vater gleich stürbe; dann hätte er pathetisch bis zum Ende »am Sterbebett« sitzen, hätte niederknien, ein Gebet hersagen und wieder abreisen können. Wieviel einfacher wäre dann alles gewesen! Aber der Vater dachte gar nicht daran zu sterben. Im Gegenteil, nun richtete er sich auf und ließ seine Stimme vom leisen Flüstern in ein vernehmliches Stottern überwechseln. Zunächst klang es mißtrauisch, dann jedoch spürte Stefan die unverhohlene Freude aus den Worten des Vaters: »Stefek, Stefek.«
»Ich hörte eben, daß es dir gar nicht so schlecht geht, und ich hatte es schon mit der Angst bekommen, als ich das Telegramm erhielt«, log er.
»Ach was, nicht der Rede wert.«
Der Vater bemühte sich, eine bequemere Haltung einzunehmen. Stefan versuchte zu helfen, stellte sich aber sehr ungeschickt an. Er fühlte die dünnen Knochen unter seinen Fingern, die Rippenbögen, die spärlichen Reste von Wärme, um die dieser dürre, hilflose Körper rang. »Hast du Schmerzen?« fragte er in Aufwallung von Zärtlichkeit.
»Setz dich aufs Bett. Setz dich«, wiederholte der Vater ungeduldig.
Gehorsam ließ sich Stefan auf der Bettkante nieder; eine unbequeme Lage, dafür aber ein rührendes Bild. Über was sollte man nun sprechen?
Von seines Vaters Gesicht hatte er nur den einen Zug im Gedächtnis behalten, dieses rückhaltlose Versenken in jene fernen Welten, da seine Maschinen Gestalt annahmen. Seine Hände waren stets von Draht verletzt, zerstochen, von Säuren verbrannt oder mit irgendeiner exotischen Farbe beschmiert. Jetzt war davon nichts mehr übrig. Das schwache Lebensflämmchen flackerte müde in den dicken dunklen Adern unter der sommersprossigen Haut.
Das bedeutete für Stefan eine schmerzliche Entdeckung.
»Ich fühle mich entsetzlich schlapp«, sagte der Vater.
»Ich wünschte, ich könnte einschlafen und brauchte nie mehr aufzuwachen.«
»Papa, wie kannst du so etwas sagen!« rief Stefan entrüstet aus. Im stillen aber überlegte er: Was erstrebt ein solcher Leib und ein solcher Kopf noch, in dem das Hirn beinahe wie der Kern einer vertrockneten Nuß klopft? Die Gelenke – quietschende, schlecht arbeitende Scharniere, die Lungen – ein Blasebalg, das Herz – eine verklemmte, undichte Pumpe. Das minderwertige Material glich einer morschen Hütte, deren Bewohner mit Schrecken sehen muß, wie sie ihm auf den Kopf fällt. Ein Vers von Sekulowski fiel ihm ein: Der eigene Leib tötet uns, da er einzig und allein den Naturgesetzen und nicht unserem Willen unterworfen ist.
»Möchtest du nicht etwas zu dir nehmen, Vater?« fragte Stefan unsicher, erschrocken über die
Weitere Kostenlose Bücher