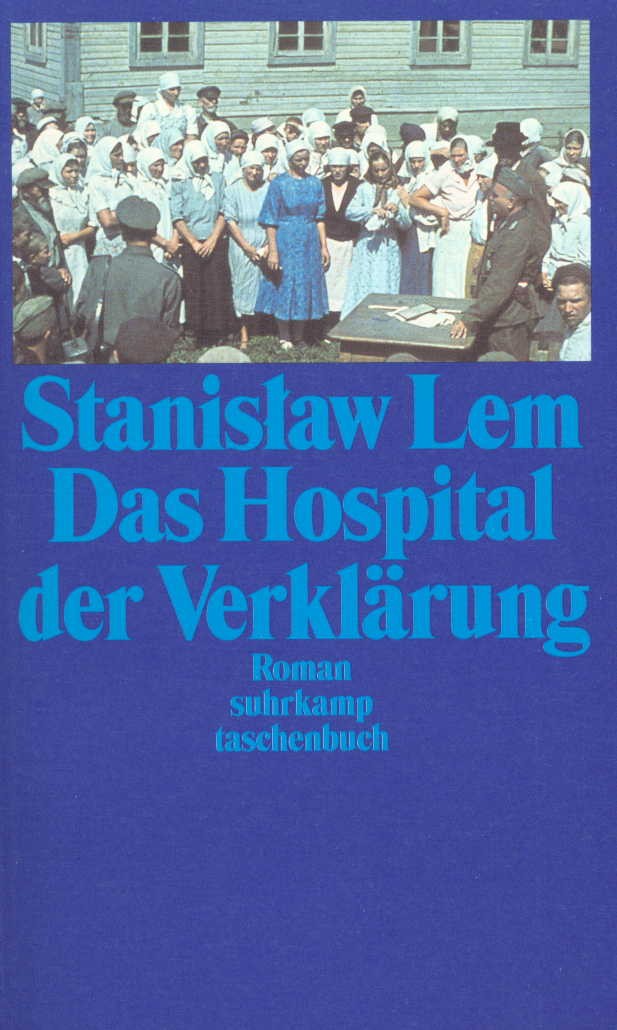![Das Hospital der Verklärung.]()
Das Hospital der Verklärung.
abzuwarten. Der Vorfall hatte ihn zu deprimiert, daß er auf den geplanten Besuch bei einem Studienfreund verzichtete und sich, durch trockenes, unaufhörlich raschelndes Laub stapfend, auf den Heimweg machte.
Der Vater saß schmatzend im Bett und kratzte mitgroßem Appetit den letzten Rest Rührei aus einem kleinen Aluminiumtiegel. Stefan erzählte ihm erregt von seinem Erlebnis.
»Ja, ja, so sind sie. Das Volk der Dichter«, meinte der Vater. »Nun, es läßt sich nicht ändern. Ihre Jugend ist so. Bis September habe ich noch mit Völliger korrespondiert, erinnerst du dich, das war die Firma, die sich für meinen automatischen Krawattenbügler interessierte. Dann hörte er plötzlich auf, meine Briefe zu beantworten. Ein Glück, daß ich ihm keine Unterlagen geschickt hatte. Verroht sind sie. Übrigens sind wir alle im Begriff zu verrohen.«
Mit einemmal schnitt er eine Grimasse und brüllte aus vollem Halse: »Mela! Melaaa!«
Stefan staunte nicht wenig, da ließen sich auch schon schlurfende Schritte vernehmen, und der Kopf der Tante zeigte sich im Türspalt.
»Bring mir doch noch ein Stückchen Hering, aber mit viel Zwiebeln, bitte. Und du, Stefek, möchtest du nicht auch etwas essen?«
»Nein … danke!« Stefan war maßlos enttäuscht. Als er Marcinkiewicz verließ, hatte er sich auf die neue Begegnung mit dem Vater vorbereitet. Sie sollte noch herzlicher werden als die erste; und nun machte der rüstige Greis mit seinem Appetit alles zunichte.
»Vater … eigentlich muß ich schon heute zurück.« Er schilderte die komplizierten Verhältnisse im Krankenhaus und ließ durchblicken, welch große Verantwortung er trage.
»Sieh dich vor …«, sagte der Vater, dem ein Stück Hering vom Teller zu gleiten drohte. Er angelte es schließlich doch, biß dazu einmal kräftig vom Weißbrot ab und fuhr fort: »Paß auf, daß du da nicht zu weit reinrutschst. Ich kann dazu zwar nicht viel sagen, aber nach jener Geschichte in Koluchowo …«
»Nach was für einer Geschichte?« Stefan spitzte die Ohren, dieser Name kam ihm irgendwie bekannt vor.
»Davon hast du nichts gehört?« fragte der Vater verwundert, während er mit der Rinde den Teller auswischte. »Da ist doch auch so eine Klapsmühle … das heißt ein Sanatorium«, verbesserte er sich, wobei er kurz zu seinem Sohn hinüberschielte, ob der sich nicht etwa verletzt fühlte.
»Richtig, eine kleine private Heilanstalt. Und was war da los?«
»Die Deutschen beschlagnahmten das Gebäude für ihr Militärkrankenhaus und schafften alle Verr … Patienten fort. Es heißt, in ein KZ.«
»Was du sagst!« rief Stefan ungläubig aus. Und dabei hatte er das jüngste deutsche Werk über die Therapie der Paranoia in der Aktentasche, das lange nach Kriegsbeginn erschienen war.
»Nun, ich weiß es nicht genau. Die Leute behaupten es. Ach so, Stefan! Sieh mal, wie konnte ich es nur vergessen! Ich wollte dir das doch gleich sagen. Onkel Anzelm ist böse mit uns.«
»Und warum?« fragte Stefan ironisch. Es kümmerte ihn wenig.
»Weil du bald ein ganzes Jahr in Onkel Ksawerys Nachbarschaft wohnst und ihn nicht ein einziges Mal besucht hast.«
»Da müßte doch eigentlich Onkel Ksawery böse sein und nicht Onkel Anzelm.«
»Laß schon. Du kennst ja Onkel Anzelm. Warum ihn sich zum Feinde machen? Also geh hin, wenn du einmal Zeit hast. Anzelm hat dich gern, wirklich.«
»Gut, Vater.«
Beim Abschied befaßte sich der Vater ausschließlich mit seinen letzten Erfindungen: Kaviar aus Sojabohnen und Koteletten aus gemahlenen Blättern.
»Chlorophyll ist sehr gesund. Bedenke, es gibt Bäume, die sechshundert Jahre alt werden! Ich sage dir, mit meinem Extrakt schmecken die Koteletts ausgezeichnet, obwohl sie absolut fleischfrei sind. Jammerschade, daß ich das letzte gestern vertilgt habe. Übrigens hat dir die dumme Mela von sich aus das Telegramm geschickt.«
Wie Stefan erfuhr, war das plötzlich eingetretene zugespitzte Verhältnis zwischen Vater und Tante, die schon das Haus verlassen wollte, der unmittelbare Anlaß zu dem Telegramm gewesen. Aber bereits vor seiner Ankunft hatten sich die beiden wieder ausgesöhnt.
»Ich hätte dir so gern ein Glas von meinem Kaviar mitgegeben. Weißt du, wie ich den mache? Ich koche Soj abohnen, färbe sie mit Kohle, carbo animalis, du kennst das ja, dann gebe ich noch Salz und meinen Extrakt dazu …«
»Denselben wie für die Koteletts?« versetzte Stefan ganz ernsthaft.
»Aber woher! Einen anderen, und der wird außerdem mit
Weitere Kostenlose Bücher